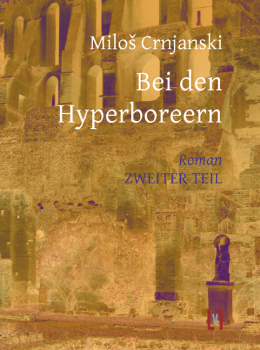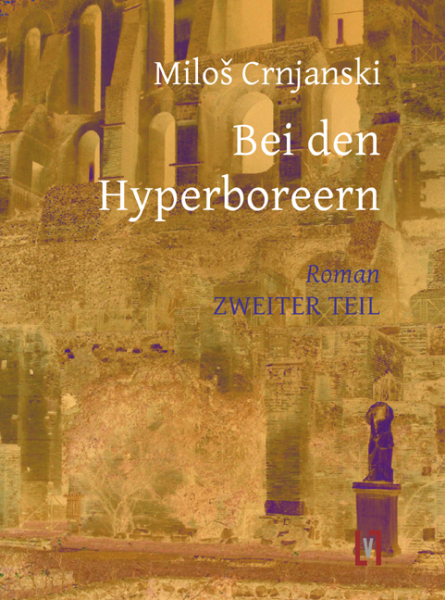





Crnjanski, Milos: Bei den Hyperboreern - Band 2
Roman
Aus dem Serbischen von Elvira Veselinovic
344 S., Festeinband
In seinem Spätwerk Bei den Hyperboreern schildert Crnjanski seine Eindrücke von Skandinavien, das er 1937 bereiste, aus der Perspektive eines serbischen Exilanten in Rom während des Zweiten Weltkriegs. „Und während ich da so sitze oder träume zu sitzen, erinnere ich mich, daß die Tundra in Spitzbergen, wenn sie blüht, viel bunter ist als der Pincio, den ich über dem Tiber erblicke.“ Die Bombardierung der europäischen Metropolen und die Judenverfolgung bedeuteten für Crnjanski den unwiederbringlichen Untergang Arkadiens. In diesem Buch geht es Crnjanski nicht darum, dem Verlorenen nachzutrauern, sondern eine letzte Hoffnung hochzuhalten, eine Wunschvorstellung, Utopie oder realistische Traumerzählung.
„Offensichtlich bedeutet dies, daß es für den Menschen nötig ist zu wissen, daß er irgendwohin nicht mehr zurückkehren kann, um zu erkennen, wie glücklich er dort war.“
Miloš Crnjanski zählt zu den herausragenden Autoren der serbischen Avantgarde. Seine poetische Prosa hat die moderne serbische Literatursprache geradezu erschaffen. Der Roman Bei den Hyperboreern kann als Synthese seines Werks betrachtet werden, in dem Visionen einer friedlichen Welt kontrastiert werden mit Schilderungen sozialer Mißstände, Rassismus und Krieg. Crnjanski zeigt sich als Autor von internationalem Rang.
Miloš Crnjanski (1893-1977): geb. in Csongrád (Ungarn), studierte Philosophie und Kunstgeschichte in Wien, Belgrad und Paris, ab 1928 Kulturattaché in Berlin, Rom und Lissabon für das Königreich Jugoslawien, Emigration nach London, 1965 Rückkehr nach Belgrad.
Elvira Veselinovic: zweisprachig in Deutschland und Jugoslawien aufgewachsen, Studium in Köln und Galway (Irland), Promotion, freiberufliche Übersetzerin und Sprachlehrerin in Berlin.
Zu Band 1: Bei den Hyperboräern
Zu Ithaka
Zu Iris Berlina
Aus dem Serbischen von Elvira Veselinovic
344 S., Festeinband
In seinem Spätwerk Bei den Hyperboreern schildert Crnjanski seine Eindrücke von Skandinavien, das er 1937 bereiste, aus der Perspektive eines serbischen Exilanten in Rom während des Zweiten Weltkriegs. „Und während ich da so sitze oder träume zu sitzen, erinnere ich mich, daß die Tundra in Spitzbergen, wenn sie blüht, viel bunter ist als der Pincio, den ich über dem Tiber erblicke.“ Die Bombardierung der europäischen Metropolen und die Judenverfolgung bedeuteten für Crnjanski den unwiederbringlichen Untergang Arkadiens. In diesem Buch geht es Crnjanski nicht darum, dem Verlorenen nachzutrauern, sondern eine letzte Hoffnung hochzuhalten, eine Wunschvorstellung, Utopie oder realistische Traumerzählung.
„Offensichtlich bedeutet dies, daß es für den Menschen nötig ist zu wissen, daß er irgendwohin nicht mehr zurückkehren kann, um zu erkennen, wie glücklich er dort war.“
Miloš Crnjanski zählt zu den herausragenden Autoren der serbischen Avantgarde. Seine poetische Prosa hat die moderne serbische Literatursprache geradezu erschaffen. Der Roman Bei den Hyperboreern kann als Synthese seines Werks betrachtet werden, in dem Visionen einer friedlichen Welt kontrastiert werden mit Schilderungen sozialer Mißstände, Rassismus und Krieg. Crnjanski zeigt sich als Autor von internationalem Rang.
Miloš Crnjanski (1893-1977): geb. in Csongrád (Ungarn), studierte Philosophie und Kunstgeschichte in Wien, Belgrad und Paris, ab 1928 Kulturattaché in Berlin, Rom und Lissabon für das Königreich Jugoslawien, Emigration nach London, 1965 Rückkehr nach Belgrad.
Elvira Veselinovic: zweisprachig in Deutschland und Jugoslawien aufgewachsen, Studium in Köln und Galway (Irland), Promotion, freiberufliche Übersetzerin und Sprachlehrerin in Berlin.
Zu Band 1: Bei den Hyperboräern
Zu Ithaka
Zu Iris Berlina
Der Eisbär erwacht
Seitdem sind fünfundzwanzig Jahre vergangen.
Ich bin auf dem Weg nach Paris und kehre in mein Land zurück, aber sobald ich die Augen schließe, wache ich in der Erinnerung wieder in Rom auf, wo zu Beginn des Herbstes 1940 der zweite Teil meines Lebens in Italien begann und die wiederholten Traumreisen in polare Gegenden, auf die ich im Sommer 1937 einen Blick erhascht hatte. Dieser Herbstbeginn war der Beginn der zweiten Hälfte meiner Lebensgeschichte in Rom. Der erste Teil war fröhlich. Der zweite traurig. Und in der Mitte dieser Geschichte (nel mezzo del cammin di nostra vita) steht die Erneuerung der Beziehungen zwischen meinem Land und der UdSSR.
Als wir gespürt hatten, dass ein schrecklicher, eisiger, frostiger Winter kommen würde, war uns unser orthodoxer Oheim im Norden, der Eisbär, wieder eingefallen. Gegen Ende dieses Sommers wusste ich, dass für mich der letzte Herbst in Italien anbricht. Dass sich das Tor des Krieges noch einmal vor mir öffnet. Der Herbst brachte den Angriff auf Griechenland mit sich.
Obwohl in Paris schon Bergson bemerkt hatte, dass nicht alles zu deuten ist, wird die Verwirrung noch größer, wenn Tränen in der menschlichen Erzählung zu fließen beginnen. In meiner Erinnerung erscheint alles von einem Licht erleuchtet, sehr klar, aber von schwarzen Pfeilen durchschossen, durchquert vom Flug dunkler Vögel, und so gerät einiges in Vergessenheit. In der menschlichen Erinnerung hört man so viel Geflüster unserer Liebsten, die verschwunden sind, das Weinen so vieler Toter, und man hört auch Glocken, Donner, Geschrei sowie wahnwitziges Gelächter. Manches, was uns als Glück erschien, ist jetzt sinnlos, ekelhaft. Und vieles, was wir gerne vergessen würden, steht vor uns und schaut uns mit tränenüberströmten Augen an. Sie fragen, wo wir sind.
Ich erinnere mich ganz deutlich, dass gegen Ende dieses Sommers Italien triumphierte wie ein Ringer im Zirkus. Ein Gladiator. Rom war in die Sommerferien gefahren, wie zu Zeiten, als Umberto König war. Umberto I. Anfang September aber kehrt Rom aus dem Urlaub zurück, taumelnd und verwundert. Man flüstert sich zu, der Krieg gehe weiter. Das sieht auch Jener ein, dessen Gesicht uns von Werbeplakaten anschaut, von jeder Wand. Faccia feroce. Il Duce.
Niemand spricht seinen Namen laut aus, aber man flüstert sich zu, es sei klar, dass Jener, der immer Recht hatte (ha sempre ragione), sich getäuscht habe. Der Krieg wird weitergehen! Ende August und Anfang September verdunkelt sich Rom. Obwohl uns die Barbaren – die von Kavafis – nicht wecken, da sie nicht gekommen sind, wecken uns nachts die Sirenen und heulen. Ich befasse mich nach wie vor mit dem Abschreiben meines Ausflugs zur Insel Jan Mayen und nach Spitzbergen und mit meinem Herumirren in Dänemark und Besuchen in Schweden und Norwegen, in einem wunderbaren Sommer. Das ist mittlerweile weder Zeitvertreib noch Zerstreuung in Rom, sondern es ist der einzige Sinn meines Lebens in Italien, am Ufer des Tiber, geworden. Ich schaue auch alle Filme noch einmal an, die ich von dieser Reise zur weißen, eisigen, ewigen Straße zum Pol mitgebracht habe. Dem Griechen Pytheas war diese Linie gallertartig vorgekommen. Bei seinem Tod wurde auch der Venezianer Marco Polo danach befragt. Man wollte ihn dazu bringen, einzugestehen, dass es Märchen waren, die er über sein Leben und seine Reisen erzählt hatte. Er antwortete: Ich habe noch nicht einmal die Hälfte von allem erzählt, was ich gesehen habe.
Zu Beginn jenes Herbstes, im Jahre 1940, erinnere ich mich – jetzt auf dem Weg in mein Land – in Rom gelebt zu haben, als hätte ich es bereits verlassen.
Wenn ich für einen Moment das Abschreiben und Durchsehen der Bilder unterbrach und frische Luft schnappen ging, auf meinem kleinen Balkon, erschien vor mir der Sant’Angelo und ich war überrascht, in Rom zu sein.
Doch man spürt auch in Rom, dass der Herbst naht, schon im September, obwohl die Sonne scheint. Das spürt man sogar in Rom, tiefer noch als irgendwo anders auf der Welt. Ob es daran liegt, dass Rom die größte Gruft der Welt ist, weiß ich nicht, aber die Herbstmelancholie verfolgt jeden bereits im September – das weiß jeder, der mal in Rom gelebt hat. Sie verfolgt ihn auch noch, wenn er Rom verlassen hat, in jeder Stadt der Welt. Obwohl die Hitze auch in jenem Jahr tagsüber groß war, auch noch im September, spürte ich, dass ich Rom verlassen werde. Ich saß und betrachtete die Wassernymphen aus Bronze auf der Piazza Esedra beim Baden, wusste aber, dass ich sie bald schon nicht mehr sehen werde.
Die Nächte waren aber auch im September schon kühl.
Obwohl ich nicht mehr oft in Gesellschaft ausgehe, weiß ich, dass Rom verbittert ist. Alle in Rom hatten geglaubt, der Krieg neige sich dem Ende zu, aber jetzt erkennen sie , dass sie betrogen wurden. Das schreckliche Bombardement Londons hören wir wie herannahenden Donner. Wenn der Winter nach Italien kommt, rechnen alle damit, dass in Rom die Straßen brennen und Frauen- und Kinderleichen auf dem Kopfsteinpflaster liegen werden. Die Freude Roms, dass das Schlimmste vergangen sei, war von kurzer Dauer. Im Kino „Quirinetta“ wird gezeigt, wie es um London steht.
Der Imperator Italiens versucht uns an den Gedanken zu gewöhnen, dass die Barbaren kommen werden. Er hat Alarm angeordnet, Sirenengeheul, sobald sich die Bomber nähern, die Neapel bombardieren.
Obwohl es weit weg ist, heulen die Sirenen in Rom, wenn in Neapel Fliegeralarm ist. Wir gehen alle in den Keller, und die aus dem Schlaf gerissenen Kinder schluchzen. Wenn die Sirenen melden, dass der Feind weg ist (und er war gar nicht da), kehren wir alle in unsere Wohnungen zurück, wie in den Himmel, um zu schlafen.
Die Frauen der Hausbewohner lächeln im Fahrstuhl. Sie wissen, dass die Männer jetzt die Gelegenheit nutzen werden. Ein Liebesintervall. Die Betten werden quietschen, und durch die Wand wird man verzückte Schreie hören: Ich liebe dich so sehr. T’amo tanto, tanto, tanto. Immer schneller und rhythmischer.
Die Einwohner Roms leben in jenem September zwei Leben.
Eines tagsüber, das andere nachts, und beide sind unglaublich. Wenn jemand unseren Eltern vorhergesagt hätte, dass wir so leben werden, hätte ihm niemand geglaubt. Man hört, auch Italien werde London bombardieren.
Man hört, die Engländer wollen Friedensverhandlungen, in Stockholm.
Im Borghese-Palast flüstert man sich zu, Italien werde bald unser Land angreifen. Der schwedische König hat schon Beratungen mit den Kriegsparteien begonnen, sagt man.
Nach all dem teilen Deutschland und Italien Rumänien untereinander auf, wie einen Käse.
Rom wird nur durch den Papst vor Bombardements bewahrt, sagt man. Man erzählt sich, er bete jede Nacht zu Gott, für uns. Damit Gott ihn besser erhört, geißelt der Papst seinen Leib wie ein Sünder – er schläft auf dem Boden.
Man sagt, er habe auch geweint.
Wir trösten uns dann. Rom wird wohl doch nicht mit Bomben überhäuft werden?
Alle, selbst die Angehörigen der untersten Schichten in Rom, sagen jetzt, der Krieg sei etwas Unbegreifliches und Wahnwitziges. Absurd. Assurdità – rufen auch die Portiers, die Kutscher, die Blumenfrauen am Fuße der Spanischen Treppe.
Sogar die Carabinieri, die das Tor im Borghese-Palast bewachen und König Alfons XIII. grüßen, der hier zu Mittag isst, im Fuchsjäger-Klub, sogar sie sagen, die Fortsetzung des Krieges sei unnötig.
Das Verrückteste ist der Fahrstuhl in dem Haus, in dem ich wohne, er macht irgendwelche Sperenzchen, wenn die Sirenen aufheulen und das angebliche Herannahen der Bomber verkünden.
Die Sirenen heulen, und unser Fahrstuhl spielt nachts verrückt. Er bleibt zwischen den Etagen stehen und will nicht weiterfahren. Die Hausbewohner im steckengebliebenen Fahrstuhl, der weder hoch noch hinunter fahren will, ähneln Papageien, die krächzen und mit den Flügeln schlagen.
Dann rumpelt der Fahrstuhl ordentlich und fährt los, rast aber wie verrückt bis zum Dachboden und bleibt erst dort stehen. Die Tür geht auf. Wenn sie endlich aufgeht, bleibt der Fahrstuhl reglos im Dachgeschoss, und die Bewohner müssen zu Fuß die Treppe hinuntersteigen.
Vergeblich wird der Fahrstuhl tagsüber repariert.
Niemand findet die Ursache der Störung.
Niemand weiß, warum er verrückt spielt.
Der ganze August und September gingen so vorüber, in jenem Jahr.
Auch tagsüber, wenn ich das Haus verlasse, geschehen alle möglichen aberwitzigen Dinge. Der italienische Geheimdienst schickte eines Nachts – während Alfons XIII. im Klub in der rechten Hälfte des Borghese-Palastes zu Abend aß – seine Agenten, um unsere Kasse aufzubrechen, in der Geheimakten und unsere Chiffre aufbewahrt werden.
Mich wollen in jenen Tagen alle sprechen. Mein Telefon auf dem Tisch klingelt.
Es läutet ununterbrochen.
Alle fragen mich das Gleiche: ob es bei uns etwas Neues gibt? Auf wessen Seite wir uns stellen?
Was ich mache? – und als ich antworte, dass ich die Fahrprüfung mache, lachen alle bissig. Allerdings musste ich in jenen Tagen wirklich die Fahrschule besuchen, in Rom.
Ich hatte genug davon, dass jeder in Rom ein Auto hatte, ich aber jederzeit bitten musste, man möge mich auf einen Ausflug mitnehmen. Ich hatte beschlossen, mir ein Auto zu besorgen – wenigstens das, was die Italiener zu der Zeit „Mäuschen” nannten – topolino. Und um Auto zu fahren, beschloss ich auch, die Kunst des Fahrens zu erlernen. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartete.
Nebenbei hatte ich auch noch beschlossen, ein Feuerzeug zu besorgen, weil ich es leid war, dass jeder in meiner Gesellschaft – besonders die Damen – mich um eine Zigarette bat. Und wenn ich sagte, dass ich keine habe, baten sie mich um Feuer.
Ich war im Krieg mit meiner Geduld am Ende, und ich brauchte Ruhe. Ruhe für meine Nerven, beim Dienst, den ich in Rom versah.
Aber meine Freunde rufen mich jeden Tag an und sagen, ich soll mit nach Apulien kommen.
Wenn ich nicht nach Apulien will, dann nach Verona.
Obwohl es dort Spuren von Normannen gibt – die ich mag, weil sie aus dem Norden sind –, habe ich in Apulien nichts zu suchen. Verona hingegen ist voller Spuren meiner Landsleute, die dort vor hundert Jahren, zu Zeiten der Österreicher, in Garnison lagen. Die Österreicher herrschten in Italien, vor hundert Jahren, bis nach Neapel, und meine Landsleute waren ihre Soldaten. Dennoch sind sie nicht bis Rom vorgedrungen, da dort der Papst war.
Verona, antworten meine Freunde, ist die Stadt von Romeo und Julia.
Nichts anderes lohnt es sich in Verona zu sehen, ruft mir die Tochter des Regierungspräsidenten durchs Telefon zu. Warum nach Verona fahren? Was sollen wir denn da?
Eine Brücke sehen. Eine Pontonbrücke. Das ist mein Lieblingsort in Verona.
Mich in meine Landsleute von vor hundert Jahren zu versetzen, erleichtert mir, mit dem fertig zu werden, was mich in Rom erwartet. Im Krieg.
Ich werde wohl nicht verlangen, dass die anderen nur deshalb nach Verona fahren?
Das ist jetzt die Stimme des Mannes der Albanerin. Ich kenne ihn. Er ist wohl am anderen Telefonhörer? – Was man denn von dieser Brücke sehen könne?
Man kann das Schicksal sehen.
Was für ein Schicksal? ruft die Albanerin, ganz erbost.
Das menschliche Schicksal, wie zwei österreichische Offiziere es vor hundert Jahren gesehen haben. Einer war ein Landsmann von mir, deshalb interessiert es mich. Sie standen auf dieser Brücke, vor hundert Jahren, und starrten auf die Etsch, die schnell und gefährlich durch Verona fließt. Voller Strudel und Wirbel. Sie stritten darum, ob jeder Mensch sein unausweichliches Schicksal hätte. Einer dachte ja, der andere nein. Derjenige, der an das Schicksal glaubte, war mein Landsmann. Er nahm nur den Säbel ab und stürzte sich in den Fluss. Er konnte sich retten.
Was mich das angehe, jetzt, hier, in Rom? fragt die Albanerin am Telefon.
Gar nichts, aber ich mag die Geschichte. Es ist offensichtlich, dass der junge Offizier NICHT an das Schicksal geglaubt hat. Er bemühte sich, zu schwimmen. Er war jung, verwegen, schön und hatte veilchenfarbene Augen. Um jene zu besuchen, die er liebte, deren Körper aber an einem anderen Ort war, ritt er die halbe Nacht hin und die halbe Nacht wieder zurück. Wir haben jetzt auch einen Fürsten, der unter den Türken geherrscht hat und auch so geritten ist – deshalb stimmt mich all das jetzt nach hundert Jahren fröhlich.
Die Albanerin ruft mir zu, man müsse sich vom Chauvinismus befreien, so etwas sei menschenunwürdig. Ich solle mich dieser übermäßigen Liebe zu meinen Landsleuten schämen. Das war eine Besatzungsarmee in Italien.
Das heißt nicht, dass ich das gutheiße, antworte ich. Ich habe nur gesagt, ich wolle nach Verona fahren, auf den Spuren derjenigen, die dort vor hundert Jahren waren. Und dieser Landsmann ist kein Besatzer mehr. Er ist schon lange im Grab. Wir werden ihn in Verona nicht treffen. Wir können in die Straße gehen, wo sie die Häuser der Familie Capulet zeigen. Dennoch bin ich froh, dass er sich retten konnte.
Der Mann der Albanerin ruft mir dann durchs Telefon zu, wir seien schuld, dass die Türken Konstantinopel erobern konnten. Die Italiener hatten es verteidigt. Die Türken haben es nicht bis nach Italien geschafft.
Soweit ich weiß, ist dort, bei der Verteidigung, auch der letzte Imperator umgekommen, und der war desselben Blutes wie ich, der Mutter nach. Es geht nicht um Chauvinismus. Es geht um die Sonne. Als in Rom schon das Christentum angekommen war, betete man dort, wo mein Land ist, noch die Sonne an, die „Unbesiegte Sonnengottheit”. Es geht um die Sonne. Hallo! Hallo!
Jemand hatte sich in unser Gespräch eingemischt. Es meldet sich der Fuchsjäger-Klub, wo Alfons XIII. oft zu Mittag isst. Ich frage mich: Alfons XIII. ist doch wohl nicht etwa im Borghese-Palast? Es gelingt mir beim besten Willen nicht, telefonisch wieder zum Haus der Albanerin durchzukommen.
*
Obwohl ich sehe, dass auch Alfons XIII. sich in die Geheimnisse des Borghese-Palastes einmischt, stehe ich am nächsten Tag früh auf, setze meine Maske der Sorglosigkeit auf und trete vor die Welt, wie ein Clown vor seine Zuschauer.
Ich öffne die Fensterläden meiner Fenster weit und bleibe für einen Augenblick so stehen, mit Blick auf Sant’Angelo. Dann hebe ich den Kopf zur Sonne und atme Rom tief ein. Morgens ist es sauber.
Vor meiner ehemaligen Wohnung stinkt der Borgo, unter dieser grünt das Gras, und rechts fließt ruhig der Tiber vorbei. Er scheint rötlich oder grün. Er vibriert und bringt die morgendliche Frische in meine Wohnung.
Dann stehe ich unter einem Schwall kalten Wassers, um den Schlaf aus den Augen und dem Kopf zu vertreiben, und während ich unter dem Wasserstrahl stehe, scheint mir, ich sei mit den Kindern in einen der Springbrunnen Roms – die alle kalt sind – gesprungen. Ich erinnere mich, wie ruhig die Springbrunnen in Córdoba und Alhambra sind – auch bei uns in Sarajevo, und wie sie plätschern, säuseln – diese aber in Rom stürzen hinab wie ein Gebirgswasserfall, wenn man in die Berge fährt. Wohin ich wohl gehen werde, wenn ich Rom verlasse?
Es gibt so viele Springbrunnen in Rom. Man sagt, Rom sei gestorben, als die Barbaren die Wasserleitung kappten, und wieder auferstanden, als die Päpste die Wasserleitungen erneuern ließen.
Dann setze ich mich, in ein Betttuch eingehüllt, auf meinen Balkon, hinter den Paravent, damit Marinetti mich nicht nackt sieht, sollte er seinen Kopf aus dem Fenster stecken. Ich trinke Kokosmilch.
Warum habe ich diesen Weg von der Kuh zur Kokosnuss zurückgelegt? frage ich mich.
Ich habe doch wohl nicht unsere kleine Kuh vergessen? In unserer Heimat. Sie hat so schöne Augen, morgens.
Der Morgen in Rom ist aber auch außergewöhnlich.
Die Sonnenstrahlen fallen schräg und sanft, wie gelbes, warmes Mondlicht, und die Strahlen dringen in die Brust ein wie angenehme Pfeile. Es ist diese einzige Sonne, die für alle scheint, für die Armen und die Reichen, die Jungen, die Kranken und die Alten. Die Sonne und Rom verschmelzen in der Erinnerung und werden eins. Nirgendwo in Europa strahlt die Sonne so. Auf keine Hauptstadt der Welt. Noch kühlen irgendwo die Springbrunnen so schön.
Allein diese Tatsache, die sich morgens in Rom wiederholt, verwandelt sich in tiefes menschliches Glück, und wir alle in Rom nehmen an diesem Ballett teil, das den Titel Il Giorno trägt. Der Tag.
Vielleicht ist dieser Morgen in Rom, diese Ruhe, mit der der Tag beginnt, deshalb so klar, weil am Abend die verborgene Trauer des Todes lauert, in Rom, das die größte Gruft der Welt ist. Das geht nur in Italien einher. Nur in Italien, in Rom, mischen sich Leben und Tod so miteinander.
Ich würde gerne mit meinem Nachbarn Marinetti darüber reden, aber als ich mich so halbnackt nach rechts hinüberbeuge, sehe ich, dass seine Fenster noch nicht geöffnet sind. Vielleicht ist er weggefahren? Vielleicht ist er noch nicht wach? Vielleicht öffnet er, nach guter alter römischer Sitte, im Sommer die Fenster nicht? Vielleicht ist er gestorben?
Vielleicht genießt er es, barfuß auf den kalten Fliesen in seiner Wohnung herumzulaufen?
Unhörbar.
All jene, mit denen ich in Rom zu jener Zeit zusammenlebte, laufen jetzt, in der Erinnerung, genauso unhörbar herum.
Mein Blick schweifte unterdessen über den Tiber und die Dächer Roms, die selbst wie eine Art Fluss erscheinen, der zwischen den sieben Hügeln fließt, aus roten Dächern. Schön ist es, wie alle diese Dächer in der grünen Linie der Berge enden, und darüber ein blaues Meer. Das ist der Himmel.
Wenn ich auf den Tiber schaue, erscheint es mir, als würde ich in ein Wasser hinabgehen, in dem wir alle versinken und uns alle sehen, wie in einem Spiegel, und von uns wird nichts übrig bleiben, wenn wir Rom verlassen.
Auf der Brücke vor Sant’Angelo scheint es, als ob sich die Bernini-Skulpturen schon davonmachen. Gebeugt, barock, von Schatten zu Schatten eilend.
Dort entlang gehe ich sonst zum Borghese-Palast – schon das dritte Jahr.
Unter dieser Brücke lauern jetzt jeden Tag die Kinder der Armen, an einem Holzsteg, und rufen mir etwas zu, wenn ich auf der Brücke stehen bleibe. Sie spielen den ganzen Tag dort, im Wasser.
Ich werde mich an ihr fröhliches Geschrei auch noch erinnern, wenn ich Rom längst verlassen habe.
Da ich ahne, dass ich nicht mehr lange in Rom sein werde, hatte ich begonnen, mich von Rom zu verabschieden, den Blick über die Dächer schweifend, bis in die Ferne zum grünen Pincio. Meine Wohnung ist wie jede andere. Sie ähnelt der Wohnung eines Eisenbahndirektors zu Zeiten Umbertos I., aber der Blick vom Balkon ist schön. Ich habe sie von einer jüdischen Familie gemietet, die sich nicht als jüdisch zu erkennen geben darf, aber auf diese Weise hofft, die Wohnung irgendwie behalten zu können. Sie sind in die Provinz geflohen. In ihrem Elend war das die letzte Hoffnung.
Sonst gehe ich die Allee am Tiber entlang zum Borghese-Palast.
An diesem Tag jedoch nehme ich nicht diesen Weg.
Mein Blick schweift noch einmal über das andere Ufer, über die roten Dächer, zwischen denen das Weiß antiker Überreste leuchtet – wie irgendwelche Steine des Polyphem aus den Versen Michelangelos. Da es in Rom zu der Zeit noch keine Industrie gab, keine Fabriken, Ruß und Rauch wie in anderen großen europäischen Städten, ist Rom noch ein Meer von Kuppeln, Kirchen, Barock und Grün entlang des Tiber-Ufers. Grüner Pinien und schwarzer Zypressen am Horizont. Es gibt keine Schifffahrt auf dem Tiber. Auch keine U-Bahn. Man hört noch nicht das Heulen und Zischen von Düsenflugzeugen am Flughafen, wie fernes Hundegeheul. Alles ist ruhig, jeden Morgen, wie vor zweitausend Jahren. Der Unterschied besteht nur darin, dass wir jetzt in Blechbadewannen baden – wer eine hat – und man damals in öffentlichen Bädern badete, in die einige tausend Badende hineinpassten.
Einst regierte in Rom morgens die große Badegemeinschaft.
Jetzt sind wir eine große Kaffeegemeinschaft.
Der Himmel indes war auch an jenem Tag blau – ohne ein einziges Wölkchen.
Ich verlasse die Wohnung, überquere aber die Engelsbrücke nicht, sondern gehe zu einer Fahrschule in der Nähe – auf dem Platz, der den Namen desjenigen trägt, der angeblich der Schöpfer des vereinten Italiens ist.
Cavour.
Hier stehen ganze Berge von Reifen, Töpfen, Eimern, Petroleumkanistern, und ein Grüppchen von Mechanikern, einige mit entblößten Oberkörpern, trinkt Kaffee.
Mich erwartet hier an diesen Tagen fröhlicher Lärm.
Die Arbeiter rufen mir zu: ob wir uns endlich entschlossen haben, auf wessen Seite wir uns schlagen wollen? Mit Italien oder dagegen?
Sie wissen, wer ich bin.
Sie fragen, ob es stimmt, dass auch mein Land in den Krieg eintritt?
Einer der Mechaniker, mit üppigem Brusthaar, verschwitzt, sagt mir laut, ich solle nicht auf das Gefasel dieser Dummköpfe hören. Sie seien sich ihres Sieges sicher. Was ihn angehe, sehe er nicht, dass der Sieg Italiens irgendetwas in seinem Leben verändern würde. Das sei nicht der Sieg der Italiener.
Ich scherze mit diesen Leuten. Ich sage: Die Italiener haben es leicht. Sie haben beim Verbündeten eine sehr gute Wahl getroffen. Das war in jenen Tagen allgemein der Spruch in Rom. Man erzählte sich, die Franzosen hätten in den Alpen furchtbare Bollwerke. Die Engländer eine sehr mächtige Marine. Die Russen hundert, zweihundert, dreihundert, vierhundert Divisionen – aber Italien hat einen guten Verbündeten. Und Rom eine ausgezeichnete Luftabwehr – und das ist der Papst. Niemand dachte damals auch nur im Traum daran, wie dieses Bündnis mit dem brillant gewählten Verbündeten enden würde. Auch ich nicht.
Um mich vor diesen Mechanikern nicht weiter äußern zu müssen, setze ich mich ans Tischchen vor der Tür, unter einem Oleander, der in einem Blumenkasten blüht, und lese Zeitung.
Mein Fahrlehrer ist mit dem Schüler, der vor mir dran ist, irgendwo hingefahren.
Die Italiener sind sehr menschlich, wenn man sie nicht verletzt, und so möchten sie auch mich in diesem Laden trösten und sagen, ich solle mir keine Sorgen machen. Was auch passiert, so lange ich in Italien bin, wird mir keiner etwas zuleide tun können. Dann vergessen sie mich schnell und setzen ihre Arbeit in dem Geschäft fort, wo Fahrkenntnisse, Benzin, Reifen und Räder verkauft werden – und das zugleich auch eine Werkstatt ist.
Nach einigen Minuten kehrt mein Lehrer zurück, schickt seinen Schüler aus dem Wagen und bittet mich hinein. Eine Fahrstunde ist vorbei, die nächste beginnt. Er sagt nichts, betrachtet mich aber, wie ein Automat.
Ich stecke den Zündschlüssel rein, lasse den Motor an, achte darauf, dass der Wagen beim Losfahren nicht hüpft wie ein Pudel, biege in die Seitenstraße ein, schalte, erster Gang, zweiter, dann rase ich am Tiber entlang bis zur Milvischen Brücke. Auf den Brücken ist an diesen Sommermorgen immer großes Gedränge. Wieder kommen ganze Arbeiterschwärme vorbei, auf Fahrrädern. Sie beschimpfen mich. Hinter uns und vor uns rasen Autos und LKWs, zahllose – wie mir scheint –, die ohne Sinn und Ordnung abbremsen oder abbiegen. Immer genau so, wie ich es nicht erwarte. Wir alle halten nur vor Verkehrspolizisten an. Mit quietschenden Bremsen. Manchmal wird um uns herum leise geflucht; sogar die Muttergottes wird nicht verschont.
"Bei den Hyperboräern ist ein Bildungsroman, lyrische Prosa, Essay und Tagebuch zugleich, in dem Michelangelo und Stendhal, Kierkegaard und Ibsen als Weggefährten des serbischen Schriftstellers aufeinander treffen. Das ausgewählte Kapitel - Zottelige Pferde auf Island - ist ein zeitloser Reisebericht über die Insel 'in wahren Farben' geschrieben, darüber hinaus ein antinationalistisches Plädoyer und ein engagierter Beitrag zur gesamteuropäischen Identität." Milorad Zivojnov
„Die besondere Anziehungskraft des Werkes besteht darin, daß sich die Genre vermischen: lyrische Prosa mündet in Essays, die in eine dramatische Form übergehen, welche wiederum von lyrischen Passagen besänftigt werden.“ Cornelia Marks
„Die besondere Anziehungskraft des Werkes besteht darin, daß sich die Genre vermischen: lyrische Prosa mündet in Essays, die in eine dramatische Form übergehen, welche wiederum von lyrischen Passagen besänftigt werden.“ Cornelia Marks
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Autor.
.jpg)