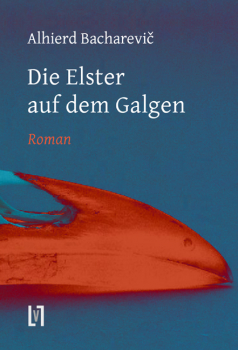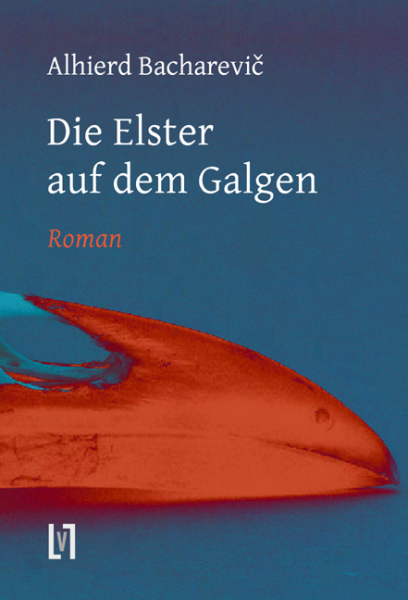





Der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung geht 2025 an den belarussischen Schriftsteller Alhierd Bacharevič - bereits 2010 ist im Leipziger Literaturverlag sein erstes Buch in deutscher Übersetzung erschienen: "Die Elster auf auf dem Galgen" - wir gratulieren herzlich.
Messerscharf seziert der Autor, wie aus der jungen Weißrussin Vieranika die loyale Mitarbeiterin des staatlichen Sicherheitsdienstes wird und sich in der Verwaltung der „Virtuellen Konzentrationslager“ hocharbeitet. Ihr Freund verläßt sie und das Land. Vieranika erschafft sich eine neue Identität und gerät prompt in die Fänge des Tyrannen Lex, dem sie willig zu Diensten ist. Dieses Buch ist nimmt nicht nur die Zustände in Weißrussland prophetisch voraus, sondern auch den Kontrollwahn der westlichen Welt. Es ist aktueller denn je.
Alhierd Bacharevic: geb. 1975 in Minsk, Philologie- und Pädagogikstudium, mehrere Erzählbände und Romane (Verdammte Hauptstadtgäste, Die Elster auf dem Galgen, Das kalte Herz) in unabhängigen Minsker Verlagen, auch Übersetzungen deutscher Literatur (Hans Magnus Enzensberger, Jan Wagner, Kathrin Schmidt u.a.), Mitglied im oppositionellen Schriftstellerverband, Stipendien des Internationalen Hauses der Autoren Graz, des Literarischen Colloquiums Berlin, der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte und des P.E.N.-Zentrums Deutschland, Auszeichnungen: Hliniany Viales-Literaturpreis, Alhierd Bacharevic lebt in Hamburg.
Thomas Weiler: geb. 1978 im Schwarzwald, Übersetzungsstudium in Leipzig, Berlin und St. Petersburg, übersetzt aus dem Polnischen, Russischen und Belarussischen, 2017 Deutscher Jugendliteraturpreis, 2019 Karl-Dedecius-Preis, 2024 Paul-Celan-Preis und August-Wilhelm-von-Schlegel-Gastprofessur für Poetik der Übersetzung. Lebt in Markkleeberg.
Alhierd Bacharevic im Radio: WDR scala, BR kulturwelt, Bilder und Video von der Lesung, DLF, DLF Büchermarkt
Autorenfoto 2010: privat
Autorenfoto 2024: © Julia Cimafiejeva
Ich könnte schon jetzt ihren Namen nennen, aber soll der Tod ruhig noch ein wenig suchen. Sie zu finden ist nicht ganz einfach – der Gang hat viele Türen und obwohl an jeder ein Schild mit Name und Zuständigkeitsbereich angebracht ist, fällt die Orientierung schwer. Ich bin der erste in der Reihe, kann aber von hier aus nur meinen Nachbarn zur Rechten sehen, alt, in einem zu kleinen, fleckigen Jackett (kein Wort über die Hosen), mit einem auffallend langen Gesicht, warzig wie ein heißer Pfannkuchen, und mit großen Händen, er weiß nicht, wohin mit ihnen. Bewegliche, flinke Finger. Deutlich ist ihm anzusehen, dass er als erster hinein möchte und dass ihm dieses Anliegen keine Ruhe lässt. Immer wieder beißt er sich auf die Lippe, er ist nervös. Die Besucher sitzen, eine zufällige Menschenansammlung, längs der Wand, manche unterhalten sich im Flüsterton. Ich überlege mir, ob unsere Warteschlange tatsächlich eine rein zufällige Menschenansammlung ist und ob es überhaupt zufällige Reihen gibt. Hier zum Beispiel, ganz unterschiedliche Bürger sind hierher gekommen, ihre Anliegen sind einander aber sehr ähnlich. Sie finden gemeinsame Gesprächsthemen. Sie lächeln einander an, wenn sie sich überraschend auf der Waldlichtung in den Beeren begegnen. Ich bin hier die einzige Ausnahme, ich bin fast tausend Kilometer hierher gefahren, um diese junge Frau zu sehen, die in ein paar Minuten tot sein wird. Und die Schlange hinter mir ist dazu da, unser Leben sauberer zu gestalten. Ich kann nicht, ich mache gleich etwas kaputt oder fange an zu singen. Nur die Ruhe, das ist bloß das Bezirksamt. Und der Name der Abteilung, in der wir uns befinden, sollte nicht mehr und nicht weniger Emotionen auslösen als, sagen wir mal, der Name der Abteilung für Gesundheitswesen. Es ist mein ganz persönliches Problem, dass ich mich einfach nicht an schwarz auf weiß geschriebene Wörter gewöhnen kann. Die auf der anderen Seite der Tür hat schnell gelernt, in der Öffentlichkeit nicht über den Namen ihrer Abteilung zu stolpern.
Ich blicke zur Tür, dort sind auf dem Schild ihre Sprechzeiten angegeben. Sie ist das Regime, sie kann mit dem einfachen Volk nicht abends oder, Gott bewahre, nachts sprechen, nur von neun Uhr früh bis ein Uhr mittags und nach der Mittagspause von zwei bis sechs. Äußerst praktisch und gerecht. Das Regime kann es sich nicht leisten, in der Dämmerung mit den Menschen zu sprechen, das Volk muss die Möglichkeit haben, ihm in die unbestechlichen, unparteiischen Augen zu sehen. Daran hat sie immer geglaubt. Endlich geht die Tür auf, aus dem Raum tritt derjenige, hinter dem ich mich vorher einmal eingeordnet hatte, sein zufriedenes Pfeifen entfernt sich langsam. Ich erhebe mich, mein greiser Nachbar ebenfalls, aus seinen Augen strahlt das Feuer des Gerechten, er findet, der Altersunterschied gebe ihm das Recht, zuerst einzutreten, ich würde ihn, wenn es so weit ist, ja wohl auch nicht daran hindern, vor mir aus diesem Leben zu gehen. Er streckt die Hand nach mir aus. Meinetwegen. Die Tür geht hinter ihm zu. Ich setze mich auf den Stuhl.
Manche Besucher können hier lesen, welche Blasphemie! Ich kann es jedenfalls nicht. Ich habe es versucht, die Buchstaben widersetzen sich dem Blick, wie ein Bissen, der nicht den Hals hinunter will. Wozu sitze ich hier, ich weiß doch genau, wie das Regime aussieht. Eine junge Frau im schwarzen Kostüm an einem Tisch aus hellem Holz, in ihrem Dienstzimmer, eine junge Frau, die ich besser kenne, als sie selbst, eine Frau, die ich mithilfe meiner schlichten Ausrüstung, die sich über die letzten Jahrtausende kein bisschen geändert hat, so häufig und so ergebnislos untersucht habe, und ich habe nichts gefunden. Einmal hatte ich ihre Spur verloren, jetzt ist keine mehr geblieben. Sie hat so gern von sich erzählt. Regima – ein schöner Name, erst unlängst in Mode gekommen, auch wenn die junge Frau ganz anders heißt, ist sie einfach das Regime, eine kleine Matroschka des Regimes, eines seiner vielen Gesichter, ein kleiner, ovaler, rissiger Stein mit zusammengekniffenen Augen, den ich rasend in einem alten Kissen versenkte, und er kam immer wieder an die Oberfläche und drückte mir gegen die Brust. Die Ohren eine Nummer zu groß, so hätte mein Freund, der Marktverkäufer es ausgedrückt, geschickt unter den Haaren verborgen, ein verdutzter Mund, nichts Außergewöhnliches. Vielleicht die Brauen – sie schienen mir bei ihr irgendwie nicht auf derselben Höhe zu liegen, daher der immer leicht erstaunte Gesichtsausdruck. Darunter kaltes Wasser, Herbst, raue Rinde. Wie sieht ihr Regiment aus? Ist es dieser Blick aus dem Fenster auf den leeren Platz, der gerade asphaltiert wird? Die Porträts der Verwandten auf dem Tisch und über ihrem Kopf? Die Tasten Alt und F4 auf der Tastatur des behördeeigenen Computers? Ihre hochhackigen Schuhe, die sie am Schreibtisch sitzend abstreift und wieder und wieder mit den Zehen betastet, als könnten sie verschwinden? Der Kalenderstapel, in dem irgendwo jemandes Telefonnummer notiert ist? Ich weiß auch so nur zu gut wie sie aussieht und kann gehen, meinen Platz dem nächsten Besucher in der Reihe überlassen, aber ich bleibe, sitze da, vielleicht, um ihr etwas zu sagen, vielleicht, sie zu retten. Aus dem Zimmer sind Geräusche zu hören, Glas klirrt, ich glaube, sie schreit, Vieranika, das strenge Kind, das endlich eine gute Arbeit gefunden hatte.
Die Elster auf dem Galgen: Alhierd Bacharevičs Roman von 2009 über Vieranikas so sinnlosen Tod
Zur Leipziger Buchmesse in diesem Jahr bekommt der belarussische Autor Alhierd Bacharevič den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2025 verliehen. Als schwergewichtiges Argument dafür gilt sein 2024 bei Voland & Quist erschienener Roman „Europas Hunde“, der in Belarus inzwischen auf dem Index steht. Übersetzt hat diesen Roman Thomas Weiler, der auch einen anderen Roman von Bacharevič übersetzt hat, der schon 2010 im Leipziger Literaturverlag erschien ... „Die Elster auf dem Galgen“ erzählt von einem autokratischen System, seiner Propaganda und der Behörde, in der die Heldin dieser Geschichte arbeitet – Vieranika, die schon auf den ersten Seiten malerisch hingebreitet – und tot – in ihrem Büro liegt. Und natürlich wartet man dann gespannt auf die Lösung des Falles, auch wenn es kein Krimi ist und außer dem Erzähler selbst der Tod der jungen Frau eigentlich völlig egal ist. Auch das ist Autokratie: Das Erlöschen von Mitgefühl für seine Mitmenschen. „Die Elster auf dem Galgen“ könnte damit auch stellvertretend für die Zustände im durchherrschten Belarus sein. Auch wenn es eigentlich „nur“ ein Bild von Pieter Brueghel aus dem Jahr 1568 ist, damals möglicherweise ein Sinnbild auf die Herrschaft des brutalen Herzogs Alba. Vielleicht. Denn die Interpretationen dieses Bildes und der Elster sind offen. Auch im Buch. Aber vielleicht muss man es auch nicht so konkret aussprechen. [Weiterlesen...] Ralf Julke, L-IZ
Freiheit, Macht und Widerstand in meisterhafter Sprache
Die Elster auf dem Galgen von Alhierd Bacharevič ist ein tiefgründiges und vielseitiges Werk, das nicht nur die belarussische Geschichte und Gesellschaft beleuchtet, sondern auch Themen wie Freiheit, Widerstand und die Macht der Sprache im Blick hat. Die Lektüre des Romans bietet eine Gelegenheit, mehr über eine Region zu erfahren, die in der westlichen Literaturwelt oft übersehen wird, und gleichzeitig die sprachliche Kunstfertigkeit eines außergewöhnlichen Autors zu erleben. In der heutigen Zeit, in der politische und gesellschaftliche Themen oft im Vordergrund stehen, ist dieses Buch eine wichtige und bereichernde Lektüre. Der Roman gibt einen einzigartigen Einblick in die belarussische Kultur und Geschichte, vor allem in die politischen und gesellschaftlichen Strukturen, die das Land prägen. Er beleuchtet die düstere und oft tragische Geschichte Weißrusslands, die sowohl von einem autoritären Regime als auch von der Zerrissenheit zwischen westlichen Einflüssen und der sowjetischen Vergangenheit geprägt ist. Für Leser, die sich für Osteuropa und geopolitische Zusammenhänge interessieren, bietet Bacharevič eine packende Erzählung aus einer Region, die bei uns oft unterbelichtet bleibt. Alhierd Bacharevič erweist sich damit auch als Zeitzeuge der politischen und kulturellen Umbrüche in Weißrussland.
Bacharevič ist bekannt für seinen meisterhaften Gebrauch der Sprache und seine magisch-symbolische Erzählweise. Die Elster auf dem Galgen steckt voller stilistischer Feinheiten und literarischer Wendungen, die sowohl inhaltlich als auch sprachästhetisch ansprechen. Der Titel des Buches selbst liefert dafür ein Beispiel: "Die Elster auf dem Galgen" geht auf ein Bild von Pieter Bruegel den Älteren aus dem Jahr 1568 zurück: Dargestellt ist eine Waldlichtung mit einem Dudelsackspieler und tanzenden Bauern, daneben ein windschiefer Galgen, auf dem eine Elster sitzt und - möglicherweise - ihre Notdurft hinterlässt. Das Bild ist eine Metapher darauf, wie wenig das Volk den Tod und die Obrigkeit fürchtet, die es zu unterdrücken versucht. Bacharevič sieht darin die Lust am Widerspruch, die Widerstandskraft der elementaren Lebensfreude, die Akzeptanz des Unvollkommenen und Fragmentarischen – Themen, die im Roman häufig aufgegriffen werden.
Sein Buch bietet eine authentische und ungeschönte Perspektive auf die sozialen und politischen Lage in einem Land, das von der Sehnsucht nach Veränderung getragen ist. In einer Zeit, in der Freiheit und Demokratie vielerorts auf dem Prüfstand stehen, ist Bacharevičs Stimme besonders bemerkenswert, da er die politischen Kämpfe seines Landes hautnah miterlebt hat. Dennoch ist Die Elster auf dem Galgen ein Buch, das universelle Themen anspricht: Es geht um Machtstrukturen, die Menschen in ihrer Freiheit einschränken, und um den Widerstand gegen diese Strukturen. So rückt die Frage nach politischer und individueller Freiheit in das Zentrum. Bacharevič bietet eine tiefgründige Reflexion darüber, was es bedeutet, sich privat und persönlich gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu stellen. Viktor Kalinke
"Ich bin fest davon überzeugt, daß dies sein erstes Opus magnum ist, mit dem er europaweit von sich reden machen wird." Jan Maksymiuk
"Das Buch des belarussischen Autors Artur Klinau über seine Heimatstadt Minsk wurde mit großem Interesse aufgenommen, und dasselbe wünsche ich seinem Landsmann Alhierd Bacharevic, dessen Roman 'Die Elster auf dem Galgen' vor kurzem in deutscher Übersetzung erschien. Eine ebenso aufschlussreiche wie beklemmende Lektüre." Martin Pollack, Dankrede zum Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung, 2011
Bestens präpariert. Zu Al’herd Bacharėvičs Roman Die Elster auf dem Galgen
Man übersieht sie leicht. Dabei sitzt die Elster im Bild Pieter Bruegels d. Ä. genau im Mittelpunkt, auf dem Galgen. Wer die detail- und anspielungsreichen Arbeiten Bruegels betrachtet, sollte lange Weile haben und ganz Auge werden. Ähnliches gilt für den Roman Die Elster auf dem Galgen des belarussischen Schriftstellers Al’herd Bacharėvič, der sich nicht nur des bruegelschen Titels bedient.
Als unscharfes Dia, projiziert auf die mit chemischen Formeln beschriebene Tafel, begegnet das Bild Vieranika wohl nur ein einziges Mal: „Ein Bild eben, Michelangelo-Raffael-Leonardodavinci, einer von ihnen würde es schon sein. Viel Wald, ein Stück Himmel, Berge. Irgendetwas Verschwommenes im Vordergrund.“ Vieranika ist nicht sonderlich motiviert, sich eingehender mit dem Gegenstand der öden Vorlesung zu befassen. Wer wollte es ihr verdenken: „Es war schließlich Herbst und sie war achtzehn.“
Al’herd Bacharėvič [Alhierd Bacharevič] präsentiert seine Hauptfigur als eher schlichtes Durchschnittsgemüt in einem (teilweise auffällig an Belarus erinnernden) autoritären Staat. Beengte Wohnverhältnisse, Pionierlagergeschichten, pubertierende Jungs, triste Studienjahre und Fluchten in virtuelle Welten – in Vieranika dürften sich viele Minskerinnen wiederfinden, vielleicht wehmütig, vielleicht auch unangenehm berührt. Die junge Frau gerät an eine Stelle in der Bezirksabteilung des staatlichen Sicherheitsdienstes und ist dem Regime treu zu Diensten. An ihrer unreflektierten Systemgläubigkeit zerbricht die Beziehung zu ihrem Freund, dem Ich-Erzähler, der sich ins freiwillige Exil einer (auffällig an Hamburg erinnernden) „nördlichen Hafenstadt“ begibt – Parallelen zu autorbiografischen Details sind nicht zu übersehen. Er blickt mit Abstand zurück auf sein Land und auf Vieranika. Und dieser Abstand lässt ihn nun auch die Elster erkennen, wo er früher nur den Galgen wahrnahm.
Dieser Plot ließe sich durchaus chronologisch erzählen. Zumal er auf ein dramatisches Finale zusteuert: „In circa fünf Minuten ist sie tot“, lautet der starke erste Satz. Von Beginn an weiß der Leser um Vieranikas Ermordung, er darf sie sogar mehrfach miterleben. Bacharėvič hat seinen Roman nämlich nicht dem Diktat der Zeit unterworfen, sondern dem des Körpers, er folgt keiner Chrono-, sondern einer Physiologie. Jedes Kapitel kreist um ein Körperteil, der zergliederte Körper gibt dem Text seine Struktur. Vieranika und mit ihr der Leser wird bald ganz Ohr, bald Haar oder Zunge. Da wird von der kleinen Vieranika, die sich an einem Eiszapfen festlutscht, zum ersten Tiefenkuss gesprungen, weiter zum Haar im Munde des Vorgesetzten und wieder zurück zum rituellen Briefmarkenanfeuchten in Kindertagen. Zunächst fühlt man sich angesichts wiederholt gekappter Handlungsfäden irritiert. Sobald man aber erkannt hat, wie souverän der Präparator Bacharėvič sein Skalpell handhabt, kann man die Irritation getrost fahren lassen und sich einfach an seinen Schnittkünsten erfreuen.
Immer wieder bricht sich die anatomische Perspektive auch in der Sprache Bahn, in Sätzen wie: „Der zentrale Schnitt führt vom Kinn zur Schambeinfuge bei linksseitiger Umschneidung des Nabels.“ Kapitel für Kapitel werden die Körperregionen Vieranikas inspiziert, wird die Mordszene neu beleuchtet und dargestellt, welche Lebensfunktionen gerade versagen, wann und wo die Tardieu-Flecken auftreten oder welche inneren Organe wie geschädigt sind. Der Autor bleibt dabei aber nicht bei der Sprache rechtsmedizinischer Obduktionsprotokolle stehen. Sie dient ihm vielmehr als Ansatzpunkt für poe(ti)sche Reflexionen. Als Subtext des Romans, bereits im vorangestellten Motto aufgerufen, ist Poes Erzählung Berenice mitzudenken. Berenice ist weit mehr als eine bloße Namensvetterin Vieranikas. Natürlich werden auch Anspielungen auf das Haar der Berenike und Seitenhiebe auf Coelho und seinem Roman Veronika beschließt zu sterben nicht ausgelassen.
Außerdem leistet sich Bacharėvič Exkurse ins florentinische Museum La Specola mit seinen anatomischen Wachsmodellen, zu einem spektakulären Mordfall im London des Jahres 1910 oder er gibt ausführliche Hinweise zum nutzbringenden Einsatz von Mascara- Bürstchen und Wimpernzange. Die offene Erzählstruktur verleitet dazu, bisweilen auch Passagen aufzunehmen, die zwar thematisch zu rechtfertigen sind, letztlich aber weder ästhetisch noch inhaltlich unentbehrlich wären. Hier hätte man sich manches Mal beherztere Amputationen von Autor oder Lektor gewünscht. Zumal die Geschichte Vieranikas in der freiwilligen Sklaverei, die Erfahrungen des Ich-Erzählers im freiwilligen Exil und die Abenteuer von Vieranikas Alter Ego Regima in einer Second-life-Welt an sich spannend genug sind. Der Präparator schneidet nicht nur gut, er hat auch hochwertiges Material unterm Messer. Mit Die Elster auf dem Galgen hat Bacharėvič einen gewagten Roman vorgelegt, der nicht nur in der belarussischen Gegenwartsliteratur seinesgleichen sucht. In der Osteuropa-Bibliothek des Leipziger Literaturverlags erscheint er nun in deutscher Übersetzung. Man übersieht ihn leicht. Thomas Weiler, novinki
-
Vito Lecteur, 07.12.2024Ein phantastisches Buch! Ein Buch über Minsk, über Belarus und zugleich ein Buch über Europa. Aufschlussreich und erschreckend.
.jpg)