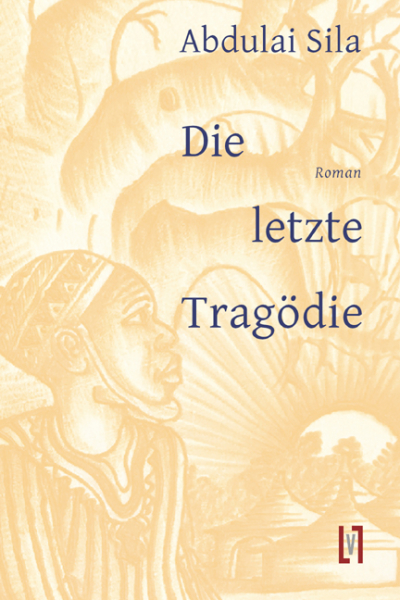



Sila, Abdulai: Die letzte Tragödie
Roman
Aus dem Portugiesischen von Rosa Rodrigues
Ndani verlässt ihr Dorf, um einem Fluch des ansässigen Zauberers zu entkommen, und sucht ein besseres Leben in der Hauptstadt. Sie findet Arbeit als Dienstmädchen in einer portugiesischen Familie. In dieser „ganz anderen Welt“ wird sie mit der portugiesischen Sprache vertraut sowie mit den portugiesischen Sitten und Gebräuchen. Sie lernt, dass weiße Herren scheinbar in allem überlegen sind...
Die letzte Tragödie gewährt Einblicke in die Kolonialvergangenheit Afrikas am Beispiel von Guinea-Bissau. Die Mentalität der Kolonisatoren wird mit den Denkweisen und Überzeugungen unterschiedlicher Vertreter der kolonialisierten Bevölkerung kontrastiert. Nicht zuletzt verkörpert Ndani das tragische Schicksal vieler afrikanischer Frauen. Abdulai Sila versteht es, die Konflikte zwischen den Kolonialherren und den Einheimischen lebendig werden zu lassen.
Abdulai Sila: geb. 1958 in Catió (Guinea-Bissau), Studium der Elektrotechnik in der DDR und in den USA, Geschäftsführer eines Telekommunikationsunternehmens, veröffentlichte vier Romane, Erzählungen und drei Theaterstücke, gründete 1994 mit zwei Freunden den ersten privaten Verlag Guinea-Bissaus, Mitbegründer des Schriftstellerverbands von Guinea-Bissau und des PEN Guiné-Bissau, dessen Vorsitzender er gegenwärtig ist, 2013 vom französischen Kultusministerium mit dem Orden Chevalier des Arts et Lettres ausgezeichnet; Sila lebt im Dorf Bissalanca in der Nähe von Bissau.
Rosa Rodrigues: geb. 1968 in Sinsheim, Studium der Romanistik und Volkswirtschaft in Heidelberg und Coimbra, Dozentin für Literatur- und Fachübersetzen sowie Repräsentantin des Camões-Instituts an der Universität Heidelberg. Neben ihrer Tätigkeit an der Universität arbeitet sie als Übersetzerin und Dolmetscherin.
Aus dem Portugiesischen von Rosa Rodrigues
Ndani verlässt ihr Dorf, um einem Fluch des ansässigen Zauberers zu entkommen, und sucht ein besseres Leben in der Hauptstadt. Sie findet Arbeit als Dienstmädchen in einer portugiesischen Familie. In dieser „ganz anderen Welt“ wird sie mit der portugiesischen Sprache vertraut sowie mit den portugiesischen Sitten und Gebräuchen. Sie lernt, dass weiße Herren scheinbar in allem überlegen sind...
Die letzte Tragödie gewährt Einblicke in die Kolonialvergangenheit Afrikas am Beispiel von Guinea-Bissau. Die Mentalität der Kolonisatoren wird mit den Denkweisen und Überzeugungen unterschiedlicher Vertreter der kolonialisierten Bevölkerung kontrastiert. Nicht zuletzt verkörpert Ndani das tragische Schicksal vieler afrikanischer Frauen. Abdulai Sila versteht es, die Konflikte zwischen den Kolonialherren und den Einheimischen lebendig werden zu lassen.
Abdulai Sila: geb. 1958 in Catió (Guinea-Bissau), Studium der Elektrotechnik in der DDR und in den USA, Geschäftsführer eines Telekommunikationsunternehmens, veröffentlichte vier Romane, Erzählungen und drei Theaterstücke, gründete 1994 mit zwei Freunden den ersten privaten Verlag Guinea-Bissaus, Mitbegründer des Schriftstellerverbands von Guinea-Bissau und des PEN Guiné-Bissau, dessen Vorsitzender er gegenwärtig ist, 2013 vom französischen Kultusministerium mit dem Orden Chevalier des Arts et Lettres ausgezeichnet; Sila lebt im Dorf Bissalanca in der Nähe von Bissau.
Rosa Rodrigues: geb. 1968 in Sinsheim, Studium der Romanistik und Volkswirtschaft in Heidelberg und Coimbra, Dozentin für Literatur- und Fachübersetzen sowie Repräsentantin des Camões-Instituts an der Universität Heidelberg. Neben ihrer Tätigkeit an der Universität arbeitet sie als Übersetzerin und Dolmetscherin.
I Eine ganz andere Welt…
„Senhora, suchen Sie Diener?“Wie oft hatte sie diesen Satz an diesem Tag wiederholt. Eine Frage, die von Hoffnung erfüllt war und die sie in vielen Häusern und verschiedenen Menschen gestellt hatte. Der Stand der Sonne schien darüber zu bestimmen, wen sie antraf: am Anfang, als die Sonne niedrig stand und noch schwach war, war sie fast immer von jungen Weißen empfangen worden, wahrscheinlich den Sprösslingen der weißen Senhoras, die sie eigentlich sprechen wollte; als dann die Sonne weiter gestiegen war, erbarmungslos brannte, und die Menschen und die Dinge aufwühlte, während dieser ganzen Zeit traf sie nur Leute an, die sicher nicht in solchen Häusern lebten, irgendwelche Hausdiener, die zwar fast alle von ihrer Rasse waren, sich aber trotzdem nicht anstellten, ihr zuzuhören, geschweige denn zuzulassen, ihr Ersuchen anständig vorzutragen; erst als die Sonne wieder schwächer wurde und der Schweiß nicht mehr von ihrem Körper tropfte, traf sie endlich auf eine passende Ansprechperson, eine weiße Senhora, die ein großes Haus bewohnte und sie zu erwarten schien.
„Senhora, suchen Sie Diener?“
Das war einer dieser Sätze, die sie in der Sprache der Weißen gelernt hatte, nachdem sie beschlossen hatte in Bissau nach Arbeit zu suchen, eine Arbeit in einem der Häuser als Dienstmädchen der Weißen. Die Idee hatte sie nach einem langen Djumbai[1] mit ihrer Stiefmutter, einem Gespräch, das sie nie wieder vergessen sollte. Ihre Stiefmutter, die von den vier Frauen ihres Vaters die jüngste war, hatte nämlich auch einige Jahre lang als Hausmädchen in Bissau gearbeitet. Sie hatte für eine weiße Senhora gearbeitet, der Frau eines sehr reichen weißen Händlers, der Geschäfte in Bissau, Nova Lamego, Teixeira Pinto, Aldeia Formosa und vielen anderen Orten besaß. Die Stiefmutter hatte ihr vom Leben der Weißen erzählt, von ihren Gewohnheiten, dem Wohlstand, dem Komfort… „Wenn ich nur halb so viel hätte wie sie“, hatte sie einmal gesagt, und schließlich mit bitterer Stimme und ebenso bitterem Gesichtsausdruck hinzugefügt, wovon sie tief überzeugt war: „Es ist eine ganz andere Welt!“ Den Rest des Tages hatte Ndani darüber nachgedacht, worin dieser große Unterschied bestehen könnte. Sie beschäftigte sich mit diesem Gedanken, bis die Nacht hereinbrach und sie sich schlafen legte. Schließlich träumte sie, wie sie selbst in einem großen Haus wohnte, das ganz weiß gestrichen war, mit vielen Hausdienern, die bereit waren, ihr zu dienen und alle ihre Befehle zu befolgen. Sie wusste nicht, was sie in Wirklichkeit dazu getrieben hatte, diese Entscheidung zu treffen, ob es dieses seltsame Gefühl der Freude war, die der Traum in ihr bewirkt hatte, oder ob es die Emotionen waren, die von den Worten ihrer Stiefmutter ausgingen. Jedenfalls begann sie von diesem Tag an, die Dinge anders zu sehen, etwas Eigentümliches trieb sie an, das Leben, das sie in ihrer Tabanca führte, aufzugeben, und es drängte sie, die Welt der Weißen aufzusuchen, die ganz anders war als ihre eigene Welt – davon war sie inzwischen selbst überzeugt. Es war sicherlich diese eigentümliche Kraft, die ihr von diesem Tag an keine Ruhe mehr ließ, die ihr auch geholfen hatte, all die Plagen, die sie den ganzen Tag über erlitten hatte, durchzustehen, und der Erschöpfung, dem Hunger und dem Durst, die ihr Vorhaben seit Stunden ins Wanken brachten, die Stirn zu bieten. Die gleiche eigentümliche Kraft, die ihr geholfen hatte, das Fahrgeld für den Bus von Senhor Costa zu prellen, der sie von Biombo nach Bissau gebracht hatte, würde ihr nun helfen, das zu finden, was sie sich so sehr wünschte. Davon zeugte die weiße Frau, die gerade mit aufmerksamem Blick vor ihr stand.
„Senhora, suchen Sie Diener?“
Sie hatte die Reise sehr genau geplant. Niemand in Biombo wusste Bescheid. Niemand, außer ihrer Stiefmutter, die auch ihre Freundin war. Sie hatte ihr diesen Satz beigebracht, den sie jetzt so oft nachsprach, und einige andere Sätze, die ihr nützlich sein konnten. Ndani hatte sich alles eingeprägt und zusätzlich noch einige Verhaltensregeln gelernt, die die weißen Hausherren von ihren schwarzen Hausdienern verlangten, die richtige Art, ihnen zu antworten, die erwarteten Gesten von Gehorsam und Unterordnung. Sie blickte auf die weiße Frau, die mit einem Schlauch in der Hand unbeirrt weiter ihre Blumen wässerte, die zwischen Haus und Mauer gepflanzt waren. Sie sah, wie sie den Schlauch fest in der Hand hielt und genau darauf achtete, dass das Wasser an den Stielen der Sträucher entlang, ein Stiel nach dem anderen, bis zu den Wurzeln sickerte. Es war eine Arbeit, die vollständige Aufmerksamkeit erforderte und bei der man lange Zeit dastehen und den Schlauch mit Behutsamkeit halten musste, um das Ziel auch zu treffen und jedes Pflänzchen in jedem Moment mit der richtigen Wassermenge zu versorgen. Eine langwierige Arbeit. Eigentlich keine Arbeit für eine Hausherrin! Das war eine Arbeit für einen Diener. „Also hat sie bestimmt noch keinen Diener“, folgerte sie mit freudigem Ausdruck im Gesicht. Endlich würde sie es schaffen…
„Senhora, suchen Sie Diener? Hmm?“
Die Senhora drehte sich zu ihr um, und ihre Blicke trafen sich einen kurzen Moment lang. Sofort erinnerte sie sich an die Hinweise ihrer Stiefmutter, die gesagt hatte, dass Hausdiener niemals den Herren ins Gesicht blicken sollten, wenn ihre Augen auf sie gerichtet waren. Deswegen senkte sie schnell ihren Blick, wobei ihre Freude noch zunahm. Wenn auch nur für kurze Dauer. Denn der Ausdruck ihrer naiven Freude verwandelte sich jäh in Überraschung und Empörung, als sie – während sie noch am Tor stand – zu ihrer großen Verblüffung in Brusthöhe ein Wasserstrahl traf. Sie hatte alles andere erwartet als dieses Verhalten der weißen Frau, die, von einem Moment zum nächsten, den Schlauch nicht mehr auf die Pflanzen hielt, sondern auf sie, die nichts weiter als ein Dienstmädchen sein wollte. Ndani machte unentschlossene Schritte weg vom Tor. Sie schüttelte die Wassertropfen ab, die durch ihr Wäschebündel zu sickern drohten. Die Wäschestücke hatte sie von ihrer Stiefmutter geschenkt bekommen. Die weißen Herrschaften mögen die Kleider der Einheimischen nicht, hatte sie ihrer Stieftochter an jenem Tag gesagt, der nun so weit entfernt schien. Ndani blickte noch einmal auf die Senhora und bemerkte mit einer gewissen Überraschung, dass sie wieder ihrer Arbeit nachging, als ob nichts geschehen wäre. Verdutzt starrte sie die Senhora an und dachte darüber nach, was passiert war. War überhaupt irgendetwas Außergewöhnliches passiert? Ja oder nein? Das Verhalten der Senhora sprach dagegen; sie verrichtete ihre Arbeit mit der gleichen Hingabe, mit der gleichen Geschicklichkeit, mit der gleichen Miene wie zuvor. Dass sie einfach so vollgespritzt worden war, war vielleicht ganz normal unter den Weißen, womöglich wurde dieses Verhalten immer dann ausgelöst, wenn sie beim Blumengießen ein unbekanntes Mädchen am Tor sahen. Sie konnte sich erinnern, dass ihre Stiefmutter einmal gesagt hatte, dass die Weißen eine besondere Zuneigung für diese bunten und zarten kleinen Dinge hätten, die sie Blumen nannten, die sie sehr teuer verkauften, einige von ihnen sahen ein bisschen so aus wie Badjiki; dabei waren sie überhaupt nicht nützlich, man konnte sie noch nicht einmal essen. Sie verbrachte einige Zeit, darüber nachzudenken, ob sie sich noch an etwas anderes erinnerte, das ihr die Stiefmutter über das Verhalten der Weißen in Bezug auf Blumen erzählt hatte. Aber da war nichts. Sie hatte ihr von allen möglichen Aufgaben berichtet, die ein schwarzer Diener für seinen weißen Herrn zu erledigen hatte, doch sie hatte nie etwas von Blumen erwähnt, die es zu gießen galt. Ihre Stiefmutter hatte damals für einen sehr reichen Geschäftsmann gearbeitet… doch in seinem Haus gab es wohl keine Blumen! Kann es sein, dass ein reicher weißer Geschäftsmann keine Blumen mag? Dann ist der Mann dieser Senhora, die vor ihr stand, bestimmt kein Geschäftsmann. Vielleicht arm? Nein, arme Weiße gibt es nicht. Oh, was für ein dummer Gedanke! Könnte es jemals einen armen weißen Mann geben, der in einem so großen und schönen Haus lebt? Ein Haus, das so aussah, wie das Haus, von dem sie geträumt hatte, nachdem ihre Stiefmutter ihr über das Leben der Weißen berichtet hatte. Ein Haus, in dem es sehr schön sein muss zu leben, so schön wie sie es in jener Traumnacht empfunden hatte. Und noch dazu mit diesen Blumen, die die Senhora gepflanzt hatte und um die sie sich von nun an liebevoll kümmern würde…
„Senhora, ich…“
„Nein!“
Die Stimme der Senhora war laut und autoritär. Mit sonderbar blitzenden Augen fixierte sie das Mädchen, das auf der anderen Seite des Tors fest seinen Wäschebündel gegen die Brust drückte. Ndani stand da wie eine Statue, wäre da nicht das aufgeregte Blinzeln. Es war als hätte sie Sand in den Augen. In einer Haltung, die den böswilligen Blick der Senhora herauszufordern schien, näherte sie sich einige Augenblicke später wieder dem Tor, immer mit den Händen über der Brust das Bündel mit der Wäsche für zivilisierte Menschen festhaltend. Sie blieb dicht am Tor stehen und erwartete, dass die Senhora sie nun vollständig, von Kopf bis Fuß, nass spritzen würde. Sobald das geschehen würde, würde sie einen Weg finden, der Senhora klarzumachen, dass sie diese ganze Arbeit problemlos für sie übernehmen könnte, dass sie auch wusste, wie man Kleider wäscht, den Boden reinigt und dass sie sogar gelernt hatte, einige Fisch- und Fleischgerichte so zuzubereiten, wie es Weiße mögen, mit Essig und Knoblauch, aber ohne Malagueta-Pfeffer. Wenn sie die Senhora überzeugen könnte, so hoffte sie, würde sie ihr das Tor öffnen und sie in das Haus führen, dieses schöne Haus, wo sie alsbald herausfinden wollte, was die Welt der Weißen so anders machte…
„Senhora…“
Es war wie ein Hilfeschrei. Ein Schrei und der flehende Blick eines Menschen, der seinen Augen nicht traute, denn, anstatt sie, wie erwartet, wieder mit Wasser zu bespritzen, ließ die Senhora den Schlauch auf den Boden fallen und ging einfach weg. Sie stellte den Wasserhahn ab, wickelte den Schlauch auf und ließ diesen in einer Ecke neben der Hauswand liegen. Dann streifte sie ihre Füße an einer Fußmatte ab und ging die Treppenstufen hinauf, die zur Haustür führten.
„Senhooora…“, schrie Ndani erneut, die immer noch am Tor stand, die Augen weit aufgerissen. Es war ein Schrei der Verzweiflung, voller Angst und Bedrängnis. Selbst als die Senhora hinter der Tür verschwunden war, blickte sie unablässig auf dieselbe Stelle, vielleicht weil sie hoffte, dass jemand auftauchen würde, um ihr das Tor zu öffnen und sie hineinzulassen.
Kurze Zeit später fuhr ein Lastwagen vorbei, der großen Lärm machte und sie wieder in die Gegenwart zurückholte, vielleicht weil sie der Lärm an den Bus von Sô Costa erinnerte. Sie schaute um sich. Es war bereits dunkel geworden, die Sonne im Horizont verschwunden. Von dem aufregenden Gewimmel in der Stadt war nichts übriggeblieben. Plötzlich spürte sie das Nagen in ihrem Magen, ihren trockenen Mund, ohne jeden Speichel, der sie über ihren Durst hätte hinwegtäuschen können. Ihre Beine wankten und Tränen flossen aus ihren Augen. Sie entfernte sich vom Tor und setzte sich an den Wegrand, ihre tränennassen Augen auf die Lichter der Häuser auf der anderen Seite der Straße gerichtet.
Was nun?
In diesem Teil der Stadt wohnten nur Weiße. Gäbe es irgendein Haus von Schwarzen, würde sie sich zusammenraffen, dort hingehen und um etwas Essen bitten. Sie war sich vollkommen sicher, dass jeder Schwarze sie in dieser Lage aufnehmen und ihr zu essen und zu trinken geben würde, wenn sie erzählen würde, dass sie seit letzter Nacht nichts mehr gegessen und getrunken hatte, dass sie den ganzen Tag von Tür zu Tür gegangen war, um nach Arbeit zu suchen, und wenn sie vor allem die Gelegenheit gehabt hätte zu erklären, warum sie nicht mehr nach Biombo zurückkehren konnte. Obwohl ihre Stiefmutter sie vorgewarnt hatte, dass Schwarze, die in der Stadt lebten, genau wie die Weißen waren, hatte sie keine Zweifel, dass sie wenigstens Wasser bekommen würde, um diesen fürchterlichen Durst zu löschen, der in ihrem Mund brannte und das Atmen so schmerzhaft machte…
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
.jpg)

