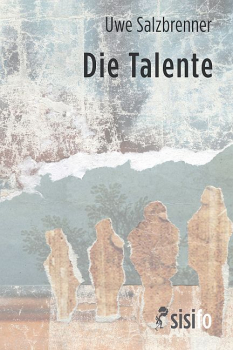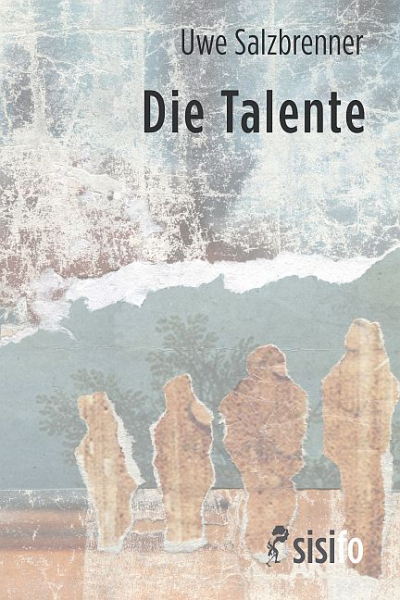



Dresden in einer alternativen Gegenwart, in der man einiges anders löst als bekannt. Doch die Utopie ist bedroht: Im Süden, in der »Zone«, leben 80.000 Menschen ohne Mobilfunk. Zum Ausgleich entwickeln sich bei manchen paranormale Fähigkeiten, Telekinese, Formen von Hellsichtigkeit. Junge Leute von auswärts versuchen, diese Talente zu erlangen. Die Bewohner der Zonengebiete allerdings sind unangenehm berührt, wenn ihre Nachbarn über die Kräfte von Poltergeistern verfügen. Es ist nicht die »Zone« des von Arkadi und Boris Strugazki erfundenen Stalkers, aber man könnte sich ihr nahe fühlen bei all den merkwürdigen Erscheinungen in Salzbrenners Roman. Eismann, Angestellter der Stadt, muss zweimal hindurch. Das erste Mal mit der Ethnologin Thrud Thorsdottir, wegen ihrer Herkunft vielleicht selbst mit Talent, die die Auswirkungen des Funklochs untersuchen will. Danach ist Thrud fort, und Eismann hat nach einem Drogenangriff das meiste vergessen. Ein Zuträger russischer Gangster, der sie begleitet hat, flüchtet, nachdem Eismann ihn abfängt. Da er nicht versteht, was um ihn vorgeht, wird Eismann zum Detektiv. Er geht erneut die Strecke ab, hört sich um, stellt irgendwann die richtigen Fragen. Die betreffen nicht nur die Paranormalen, sondern auch jene, die mit ihnen zu tun haben. Wie bei den Strugazkis sind es bei Salzbrenner am Ende Fragen der Ethik.
Uwe Salzbrenner: geb. 1960 in Hoyerswerda, Abitur, Kraftwerksmaschinist, Diplomingenieur für Elektrotechnik. Schreibt seit 1993 für Tageszeitungen. Wohnt in Dresden. Nach zwei Bänden Kurzprosa und einer Kriminalnovelle erschien 2013 im Leipziger Literaturverlag der Novellenband »Hinter der Membran«. Außerdem Lyrik, Prosa und Reisetagebücher in Literaturzeitschriften; Beitrag zur Anthologie »Weltbetrachter« (2020).
1
Thrud kommt zu Fuß zum Rand Dresdens, hochgestimmt, neugierig, etwas verwirrt. Der Computer des Mietwagens hat sich auf halbem Berg mit einem stöhnenden Geräusch abgeschaltet, aber zuvor den Gurt und die Türsicherungen aufklacken lassen. Es ist heiß, als sie aus dem Fahrzeug steigt. Als stünde sie unter einem Haartrockner mit außergewöhnlich schwachem Ventilator. Die Sonne brennt ihr ins Genick, sofort schwitzt sie am Rücken unter dem kleinen Rucksack. Der Trolley holpert über Asphalt. Dazu wie jedes Mal das Gefühl in einem fremden Land, überwältigt zu sein. Wie auf einem fremden Planeten: Jedes Ding glänzt, jedes zieht sie an. Sie sollte nicht so genau hinschauen. Zur Beruhigung versucht sie, die Baustile zu klassifizieren: gemauerte Steinkästen vom Ende des 19. Jahrhunderts mit ausgebauten Dachgeschossen, wie aus dem Dokumentarfilm. Häuser im Eigenbesitz, vielleicht vom Beginn des neuen Jahrtausends. Stabiler und haltbarer, als sie Gebäude aus Amerika kennt. Und ein Oberflächeneffekt scheint Unterschiede zu verwischen. Ein großes Gebäude, vermutlich eine Garage für Händler, sieht im Nachbild bei geschlossenen Augen wie aus schwarzen Kabeln geflochten aus. Die Stränge des Erkers in unregelmäßigen Abständen umhüllt mit leuchtendrotem Stoff, merkwürdigen Gespinsten, vielleicht zwanzig Zentimeter lang.
Dort wabert die Luft, flackert wie eine unsichtbare Flamme. Sie zieht ihr Köfferchen hinter sich her. Wichtig: die Hitze zu ignorieren wie jede Störung. Sie kann sich nach außen hin anpassen, das braucht man im Beruf. Und jedes Ding stört sie, schabt, stört, prägt sich ein —
Die Hose drückt und schneidet, noch vom Autositz.
Sie erinnert sich, dass hierzulande nicht eine Stadt die andere ersetzt, selten ein Gebäude das andere. Hier wird repariert, geputzt, gestrichen, so wie daheim die Touristenviertel hergerichtet sind. Die meisten Vorrichtungen dienen zur Umkehr der natürlichen Lichtverhältnisse: Spiegel, Jalousien, Blenden. Tarnung und Abschottung. Dahinter manche Fensterflügel weit offen.
An den meisten Häusern glitzert und glänzt zudem der Putz tatsächlich, so wie man es von Kalifornien berichtet. Thrud findet Fensterkreuze und Schattenrisse in einem verblüffenden Gleichklang. Vielleicht ist man bereits dabei, das Viertel für die Zukunft zu konservieren. In der Regel gehört zu den Häusern ein kleiner Hof oder ein Stück Wiese. Sorgfältig eingezäunt der Müll, damit ihn der Wind nicht herumwirft. Möglicherweise lassen sich damit noch Geschäfte machen.
Menschen sieht Thrud kaum. Diese typisch amerikanische Abwesenheit jedes Lebendigen, von ein paar Hunden abgesehen, gibt es also auch hier. Halbnackte Körper, kurz sichtbar in Zimmerhöhlen. Stets die gleiche Überraschung: Die Fenster lassen sich hier vollständig öffnen.
Aber nirgends ein Händler, der kalte Getränke verkauft. Vielleicht der letzte Augenblick, der noch zu ihren Beruf und nicht zur Mission gehört, einer extrem kurzen Mission.
Und die Fragen, wie überall: Könnte sie hier leben? Kann man in der Fremde ein besseres Leben führen? Nimmt man ihr nicht alles weg?
Die zweite Überraschung, die Thrud sehr wohl bekommt: wie eng am Stadtrand von Dresden die Grundstücke mit Weiden und Gärten verzahnt sind. Klein und dürr und verzahnt. Auf das Grundstück neben dem Weg werden von Zeit zu Zeit Rinder getrieben. Sie kennt die Gegend vom Satellitenfoto und ist mit der Computerlupe über das Kartenbild geglitten. Sie glaubt, sie zu kennen, die Wege, die vermeintlichen Abkürzungen, Sackgassen. Jetzt aber dieses Blühen in der Trockenheit, die Büsche, der Überschuss. Sogar eine mit Asphalt versiegelte Brache liegt hinter blühendem Gestrüpp.
Winzige Hütten aus Holz dienen den Einheimischen wohl als Sommerküchen, die Fenster und Türen sind nicht durch Gitter geschützt. In noch winzigeren gläsernen Hütten reift Gemüse. Bald schon an den Zäunen die Coquilles, diese wurstähnliche Krautröhren, die sie hier anbauen. Thrud hat sich daheim informiert: Sie pumpen sich beim Wachsen voll Gas und bieten ab dem Mittsommer bis in den Herbst hinein einen nahezu perfekten Schutz vor Sonne und fremden Blicken.
Der Weg führt über den Kamm. Bald geht es auf der anderen Seite die Straße entlang ins Zentrum Dresdens hinunter. Eine Tischlerei linker Hand, die Fensterläden geschlossen, quer über die Straße eine Eisenbahnbrücke. Wenn es hier eine Fabrik gegeben hat, welche den Menschen Geld gebracht, ist sie längst geschlossen und abgerissen. In jedem Haus ist so still. Keine Vögel, kein Betrieb auf der Straße, keine lauten Stimmen. Die Häuser vielleicht leer. Da hat sie sich schon oft geirrt. Nur ein alter Mann, er fährt sein Fahrrad ohne zu keuchen, doch mit erschütternd starrem Blick ihr entgegen. Als könnte er sich allein mit den Augen an den Straßenmarkierungen den Berg hinaufziehen.
Dann eine Frau in den Vierzigern. Was sucht sie, ihre Katze oder ihr Kind oder eine Maschine? Thrud kann die Beobachtung nicht abschalten. Gegrüßt wird im Freien offenkundig nicht, vor allem keine Fremde.
Als sie die am Wegrand geparkten Autos inspiziert, lassen sich weitere Indizien des Funklochs erkennen. Die Fahrzeuge sind älteren Jahrgangs, die einen menschlichen Fahrer und Benzin benötigen, jedoch nicht auf Mobilfunk angewiesen sind. Die Sondergenehmigungen des Prüfdienstes: sichtbar hinter den Frontscheiben. Meist große Modelle, um auf Reichtum hinzuweisen, obwohl man nicht länger am Fortschritt teilnimmt. Hier irgendwo muss irgendwer bemerkt haben, wie es anfängt: Steuerungen fallen aus, automatische Nachrichten mit Daten werden nicht verschickt, überwachte Motoren bleiben stehen, man kann nicht mobil telefonieren. Thrud fehlt jetzt schon die Wettervorhersage, das Programm zur Essenzubereitung, der elektronische Familienanschluss, sie will es sich nur nicht eingestehen. Noch ein letzter Versuch: Das Smartphone bleibt unverbunden. Sie rollt es zusammen und steckt es ein.
Ein Sattelschlepper wird an einem Longenwagen aus dem Gewerbegebiet geführt.
Dies ist ihr Auftrag: die Bedingungen der Feldarbeit einer Ethnologin zu ermitteln. Weil in der sogenannten »Zone« der Mobilfunk nicht funktioniert, steht Thrud am Berg im Dresdner Süden, inspiziert blankgeputzte und wieder eingestaubte Autos. Bereits tote Dinge können viel erzählen, wie sich eine physikalische Störung auf das soziale Leben auswirkt. Die Autos sind momentan die einzigen Dinge, an die Thrud heranreichen kann. Jedes weitere Ding ist sorgsam eingezäunt und weggeschlossen: eine Hecke, glatt geschorener Rasen. Die hallenden Stimmen aus dem Keller. Apfelbäume als Zierde, alte Bäume, zersägt, Nadelgewächs in Form geschnitten. Regenwassertonnen mit Deckel. Sie kann keinerlei Folklore erkennen und vermutet ein Täuschen nach festen Regeln. Die Vorgärten sind womöglich eine familienbiografische Skulptur, ein Denkmal zu Lebzeiten.
Auch hier kein sichtbarer Schutz vor Einbrechern. Die Häuser sind, das sieht sie jetzt, in ihrem Glanz verblüffend interesselos gepflegt. Stets bloß Tricks, Fassaden blinken zu lassen. Auf den Dächern Schornsteine, Heizungen für den Winter, aber keine Klimaanlagen, obwohl das Geld vorhanden sein muss. Womöglich eine Manie, Energie zu sparen. Offenkundig, sie sieht mehrere Antennen, ist hier Radio-Empfang nach wie vor möglich. Ein Altersanzeiger der Bewohner: wahrscheinlich über sechzig.
Eine Schlafstadt für Pendler ist das Viertel, sofern ihr Urteil hier gilt. Erst, als die Straße nicht länger so steil den Hang herabstürzt, rücken die Häuser fast an den Gehweg heran. Die Eingänge im Hof, nicht zu sehen.
Es sind zu viele Geräte da, die sie absurd findet. Der Putz von nahem: dann doch nicht so hart und glatt. Manchmal gibt es sogar keinen Putz, sondern ein Gerät, das eine Fassade bloß vorgaukelt. Das ist schon wieder interessant. Später das viele Grün, Streifen von Wald, die Reihen Obstbäume. Die Ordnung und Sicherheit. Und wieder die Ruhe, eine erschütternde Stille, die von vorbeifahrenden Autos einen Rhythmus bekommt.
Es fahren sehr wenige Autos. Sie hat den Punkt verpasst, von dem aus Dresden gut zu überblicken ist.
Ein Kennzeichen von Kultur ist es, Paradoxien auszuhalten.
"Vieles bleibt offen in diesem Roman, lässt Raum für Interpretationen. Auch wenn der Roman in einer alternativen (nahen) Zukunft spielt, in der der Klimawandel offenbar bereits deutlich spürbar ist, handelt es sich weniger um eine Science Fiction-Erzählung, als vielmehr um die beklemmende Schilderung einer modernen Gesellschaft, die sich abschottet, Fremdem mit Ablehnung und Misstrauen begegnet und Gewalt mit erschreckender Gleichgültigkeit einsetzt. Eismann scheint in dieser Gesellschaft als einziger moralisch zu handeln, kühl und unbestechlich. Und findet sich selbst auf seiner Suche, fühlt sich am Ende gar erlöst. Ist er also letztlich auch eine Heilsgestalt? Das bleibt abzuwarten." Christine Witt, AndromedaNachrichten, 286, 2024, S. 50
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
.jpg)