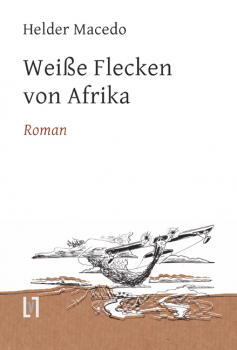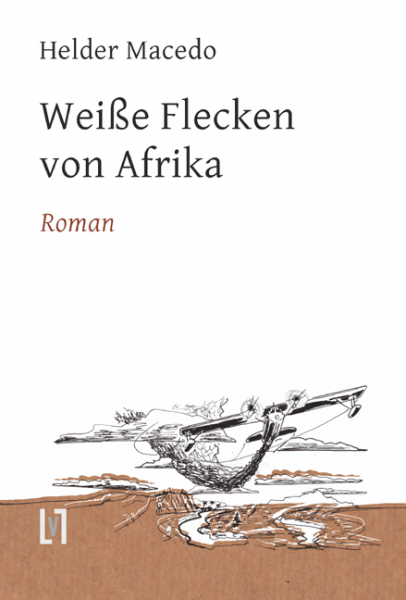





Macedo, Helder: Weiße Flecken von Afrika
Roman. Aus dem Portugiesischen von Markus Sahr
Dieser autobiografische Roman liefert ein Bild der portugiesischen Diktatur vor ihrem Untergang und eröffnet eine Sicht auf das Problem der Kolonisierung im allgemeinen. Der Leser erlebt hautnah den Übergang der ehemaligen Kolonien zu den neuen afrikanischen Ländern.
In Südafrika geboren, wächst der Erzähler in Mosambik auf. In den Kolonien führen die portugiesischen Verwalter häufig eine Willkürherrschaft: Einer von ihnen richtet seine häuslichen Untergebenen beim Servieren zu Duetten aus Carmen oder Tosca ab. Gelingt es den Eingeborenen nicht, ihn zufrieden zu stellen, läßt er sie auspeitschen.
Demgegenüber sorgt sich der Vater des Erzählers um eine nachhaltige Entwicklung der ihm anvertrauten Distrikte: Er läßt Straßen und Hospitäler bauen, kümmert sich um die vielen Leprakranken und gründet Schulen. Erst zum Studium wechselt der Sohn für längere Zeit nach Europa, durchstreift als Bohèmien Lissabon und beteiligt sich am Wahlkampf des oppositionellen Generals Humberto Delgado. Einem drohenden Zugriff durch die Geheimpolizei entzieht er sich durch die Flucht nach Südafrika und anschließend nach England. Er bereist Guinea-Bissau und die Kapverdischen Inseln kurz nach deren Unabhängigkeit und glaubt, mit diesen Aktionen über seinen Vater zu triumphieren.
Doch die Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten markiert nur den Beginn einer neuen Beziehung zwischen portugiesischer Kultur und afrikanischen Nationalismen. Schließlich muß der Erzähler erkennen, daß auch er selbst von seinen afrikanischen Freunden als Teil der früheren Besatzungsmacht aufgefaßt wird - ein Prozeß, der das reale Geschehen wie den Roman als unabgeschlossen erweist.
Helder Macedo: geb. 1935 in der Nähe von Johannesburg, lebte in Mosambik und Lissabon, seit 1960 in London, Romancier, Essayist und Lyriker, von 1982 bis 2004 Inhaber des Lehrstuhls Camões für Portugiesische Literatur am King’s College
Mit Mozart in den Kolonialkrieg
von Peter Koj, Buch des Monats, August 2011, Portugiesisch-Hanseatische Gesellschaft Hamburg
Weiße Flecken von Afrika: Eine Spurensuche in verschwundenen Kolonien und einer verpufften Diktatur
Ralf Julke, L-IZ
⇒ www.l-iz.de/Bildung/Bücher/2011/01/Weisse-Flecken-von-Afrika-Eine-Spurensuche.html
Helder Macedo im Gespräch (mdr figaro):
- Teil 1 ⇒ l-lv.de/autoren/hoerproben/2011_05_23_Macedo_Afrika_1_mdr.mp3
- Teil 2 ⇒ l-lv.de/autoren/hoerproben/2011_05_23_Macedo_Afrika_2_mdr.mp3
Leseprobe:
DIE AUTORITÄT, DAS KINO UND DIE FOLGEN VON LAUNEN
Wenn die Zukunft die Vergangenheit auch unvermeidlich hervorbringt, so verträgt sich die Vergangenheit, ehe man weiß, was sie ist, mit derart geschichtlicher Vorherbestimmung doch schlecht und kann lediglich eine Frage von Verstimmung sein, wie bei Onkel Pedro während des Besuchs von Senhor Tomás Vieira.
Onkel Pedro war damals Sekretär meines republikanischen Großvaters, und Senhor Tomás Vieira lebte vom Kino, oder vielmehr, er zeigte Filme. Er war ungeheuer schlank; in den zwanziger Jahren war er Schauspieler beim Stummfilm gewesen, nach Mosambik emigriert, wo er sich einen gepanzerten Lastwagen anschaffte und die Aufführungen, à la Hanswurst, mit einem Stepptanz in riesigen Schuhen begann, von der Musik eines Grammophons begleitet. Er fuhr überall hin, wo man ihn rief, manchmal auch, ohne daß man ihn gerufen hätte, und stets war es ein großes Trara. Ihm habe ich meinen ersten Film zu verdanken, Der Kapitän der Wolken. Sofort wollte ich Pilot werden: ich stellte einen Stuhl vor den anderen, der Hund als Kopilot auf dem hinteren Sitz, und so beschossen wir die Deutschen mit dem Maschinengewehr. Tomás Vieira starb 1979 völlig vergessen in Lissabon, als ich gerade zum Staatssekretär für Kultur ernannt worden war. Niemand begriff, welche finsteren politischen Absichten mich dazu bewegten, zu seinem Begräbnis zu gehen.
Der Großvater war nach Ende des Ersten Weltkriegs in den Verwaltungsstab aufgerückt und befand sich als Kommissar für die Eingeborenenpolitik in Ressano Garcia. Der Grenze zu Südafrika wegen war es ein besonders heikler Auftrag. Die Sache mit Delagoa Bay war noch heiß, die Erinnerung an das Ultimatum noch frisch. Der Krieg und die diplomatischen Bemühungen der Republik hätten die portugiesischen Kolonien zwar gerettet, doch gab es gleichfalls das Abkommen, im Austausch gegen die Eisenbahn und den Hafen von Lourenço Marques Arbeitskräfte zu den Minen in Rand zu exportieren. Nach dem Waffenstillstand war England erneut ein notwendiges Übel geworden, doch schamlos und zynisch, wie es nun einmal war, konnte man ihm, wie zu Guerra Junqeiros Zeiten, nicht trauen. In Lissabon hatte der Großvater in seiner Jugend Prozessionen gestört, er war ein Freund von Magalhães Lima gewesen, und durch ihn ist er, glaube ich, Freimaurer geworden; er kämpfte gegen die Truppen von Lettows im Norden von Mosambik, verlor im Gefecht bei Negamano das rechte Auge, meldete sich, sobald er es konnte, beim Roten Kreuz und war bereits an der Seite von Massano de Amorim in der Offensive von Angoche; er nahm „Brito Camacho brüderlich in den Arm“, als der als Hoher Kommissar eintraf, und schien nun, geschützt durch sein Kriegsverdienstkreuz, das Malteserkreuz und das Kreuz des Christusordens, den Regimewechsel in der Hauptstadt überstanden zu haben. Seine Schuld war es nicht, wenn die Engländer uns übers Ohr hauten.
Ein Beispiel:
Ein umherziehender Sklavenhändler hatte versucht, den Häuptling einer mehr zu der Grenze hin gelegenen Gegend mit ein paar Stücken goldenen Pfunds abspenstig zu machen. Da der Häuptling – „ja, der war ein wirklicher Portugiese!“ – sich jedoch widersetzte, ließ er ihm die Strohhütte anzünden, um ihn gefügig zu machen, wenn er das nächste Mal mit dem Geld käme. Der Fall war ernst, denn hätte der Häuptling gesagt, der anderen Seite anzugehören, wäre die portugiesische Souveränität über jenen entlegenen Spitzteil des Territoriums nur schwer zu beweisen gewesen. Der Großvater las seine Geschichtsschreiber wieder, dachte an König Dom João II und den Marquês de Pombal , lud den Sklavenhändler zu einem opulenten Frühstück ein und gratulierte ihm dazu, den Häuptling an den ihm gebührenden Platz gestellt zu haben. Dies freilich reiche nicht aus, nötig sei vielmehr eine Demonstration militärischer Stärke. In der Gewißheit, daß niemand auch nur im Entferntesten etwas von seinen wahren Vorsätzen ahnte und eine desaströse, ungerechtfertigte Militärintervention diesen eher nutzte, war der Sklavenhändler mit dem Vorschlag sofort einverstanden und übertrug die Einzelheiten seiner eigenen Perfidie auf den Häuptling: „ein Bandit in den Diensten der Engländer, ein Befürworter der Sklaverei, der uns Bewohner und Land rauben will“. „Wenn dem so ist, verdient er den Tod!“ Wäre er, der Händler, bereit, die notwendigen vertraulichen Anweisungen gleich mitzunehmen und sie mit eigenen Händen zu übergeben, um Wort für Wort alles zu erklären, was er wußte? Aber selbstverständlich. Die Anweisungen wurden in seiner Gegenwart mit lauter Stimme niedergeschrieben, und er selbst half, die Petschaft dem Siegellack aufzudrücken. Nur daß die Anweisungen, die er in einem zuvor ausgestellten, identischen Umschlag mitnahm, den Verrat des Überbringers erklärten und in gedrängter Form endeten: „Man beseitige ihn“. Es war die Geschichte, die die Witwe, schon in Jahren fortgeschrittener Sklerose, am liebsten erzählte. „Aber Mama, willst du damit sagen, daß der Papa befahl, einen Menschen zu töten?“ „Aber ja, meine Tochter, er besaß doch die Macht dazu und noch zu ganz anderen Dingen!“
Ganz sicher besaß er die Macht, um Senhor Tomás Vieira kommen zu lassen. Der Grund für das Ereignis war Onkel Pedros Charakter. Der war in eine „hübsche, anmutige Eingeborene“ verliebt, „schlau wie alle aus ihrer Rasse, doch sehr hellfarbig“, die ihm den Kopf verdreht hatte, ohne Ehe jedoch nichts gewährte. In ideologischer Hinsicht hatte der Großvater dagegen nichts einzuwenden, Ehrenwort eines Demokraten!, der Junge, ein bißchen schüchtern, aber ginge am Ende noch in die Falle, mit tiefen Ringen unter den Augen und maulend schlich er umher, zwei oder dreimal schon hatte er sich in romantischen Umschreibungen verheddert, die nur Heiratsabsichten bedeuten konnten. Es war nötig, ihm eine Hilfe in die richtige Richtung zu geben: eine Kinovorstellung! Preiswertes Essen und Wein, die Lichter während der Vorführung gelöscht, danach Tanz im großen Salon, das Mädchen bei so vielen neuen Eindrücken in der richtigen Stimmung, Pedro endlich im Angriff, und alles in einer Nacht abgemacht. Der Plan hierzu wurde mit demselben strategischen Eifer umgesetzt, der dem Sklavenhändler gegolten hatte, und einen Monat später bereits war Senhor Tomás Vieira mit Rudolf Valentino zur Stelle, per Telegraph durch rigorose Ausführungen über die Aufteilung der reservierten Plätze in Kenntnis gesetzt: im Mittelpunkt ein Sessel mit einem stattlichen Schild an der Rückenlehne, auf dem in Großbuchstaben AUTORITÄT zu lesen stand; gleich links daneben, unter dem wohlwollenden Blick der Autorität, Onkel Pedro; und vor ihnen das Mädchen. Das begann während des Abendessens der sich dort abzeichnenden Zukunft entgegenzulächeln, sah diese Zukunft in der Platzreservierung für den Film bestätigt und entfernte während der Tanzvorstellung das Haar aus dem Genick, zeigte, als sie sich bückte, um während der Vorführung des Weißen Scheichs... eine Träne zu trocknen, etwas mehr von ihrem anmutigen Nacken, und Pedro: nichts! Worauf der Großvater, um ihm rein didaktisch zu zeigen, was in solchen Umständen zu tun sei, und ihm pragmatisch beizustehen, den Schnurrbart und den übrigen Bart zurückstrich, sich majestätisch nach vorn beugte und jenem kleinen Nacken, der dies schon so lange begehrte, seine eigene Hommage darbrachte. Und nach vorne gebeugt, ließ der es zu, von diesen Lippen wieder und wieder beehrt zu werden, von denen er annahm, es seien die Onkel Pedros (oder nicht?), bis die Lichter im Saal endgültig angingen. Nur daß Onkel Pedro sich eben weigerte, zum Tanz zu gehen, und es ganz und gar nicht lustig fand, so sehr der Großvater ihm am folgenden Tag das Witzige daran auch nahebringen wollte – „wenn sie die Lippen des Kommissars nicht von meinen zu unterscheiden weiß...“ –, und sich wenig später entschloß, nach Portugal zurückzukehren, wo er das tugendhafteste Mädchen der Christenheit und aus ganz Torre de Moncorvo heiratete. Beim Abschied riß der Großvater in einer charakteristischen, noblen wie sentimentalen Geste einen Brillantring vom Finger und reichte ihn ihm vor der letzten Umarmung: „Sei glücklich, mein Junge! Ich wollte dein Bestes!“
Die ferne, in Trás-os-Montes vollzogene Hochzeit jedoch sollte nicht die einzige sein, die von Senhor Tomás Vieira inspiriert wurde. Der jüngere Bruder, dem dieser künftige Onkel das niemals gebührend anerkannte Privileg schuldete, einmal mein Onkel zu werden, war unter dem unwahrscheinlichen Vorwand, den Film anzusehen, einen ganzen Tag von Lourenço Marques aus unterwegs gewesen, in Wirklichkeit aber, um zu sehen, was aus der Tochter des Kommissars geworden war. Die war soeben aus Odivelas zurückgekehrt, und er hatte nie das rothaarige Mädchen vergessen, das vor einigen Jahren dorthin abgereist war. Was er sah, gefiel ihm, sie heirateten, sie mit siebzehn, er mit zweiundzwanzig. „Ein schöner Junge mit einer großen Zukunft“, wie der Großvater in Gegenwart seiner liebsten Tochter mehrfach gesagt hatte, zufällig, als spräche er zu allen außer ihr. Da man die großväterlichen Schliche nun etwas besser kennt, stellt sich die Frage, ob der wahre Vorsatz der Einladung an Senhor Tomás Vieira am Ende nur das Wohl Onkel Pedros gewesen ist.
Der Großvater lernte seinen ersten Enkel noch kennen, ehe er zur Ilha de Moçambique und damit zum Höhepunkt seiner Macht weiterzog. Zum Verwalter ernannt, richtete er sich in dem noblen Renaissancepalast ein, als hätte er die Räume nach seinen Maßen in Auftrag gegeben: ein privater Kai, eine Rikscha, ein prächtiger indo-portugiesischer Thron, der jedes Wort überflüssig machte, das Autorität bedeutete. Sogar einen Fisch gab es dort, den man „Intendantur“ nannte, da er einen rötlichen Bart besaß, der seinem glich. Ein absoluter Despot. Von der aufgeklärten Sorte allerdings: er haßte die Jesuiten (für ihn waren das alle Pater) und versuchte, für alle Kinder des Distrikts die Schulpflicht einzuführen, „ohne Einschränkungen der Rasse und einschließlich der Mädchen, die die Mütter des künftigen Fortschritts“ seien. Das Projekt wurde als unrealistisch erachtet, und selbst wenn man es anders eingeschätzt hätte, so hätte es doch keine Priorität besessen, und die Prioritäten wurden ihm von dem Gouverneur diktiert. Er antwortete in einem amtlichen Schreiben, Mouzinho paraphrasierend, der, „obwohl Anhänger der Monarchie, ein Mensch war“: „Ich habe um Schulen ersucht, nicht um Ratschläge“. Und so war sein größter Beitrag eine aktive Beteiligung daran, daß die Mädchen der Insel, und zwar ohne Unterschiede der Rasse, künftige Mütter wurden, als er dort de facto das feudale Recht der ersten Nacht wiedereinführte, was seine jakobinische Ideologie de jure bis zum letzten Blutstropfen bekämpft hätte.
In einem öffentlichen Angriff jedoch auf „diese Hostienlutscher, die nun an der Macht waren“, zitierte er das Programm von Brito Camacho, „des guten Freunds, der zu einem verehrten Meister geworden war“: „Man muß die Eingeborenenfrau, eine Sklavin des Vaters, der Geschwister, des Ehemanns, emanzipieren und darf dabei nicht vergessen, daß ihr Schoß die fons vitae ist, in der die zukünftigen Arbeiter gezeugt werden. Man muß den Eingeborenen kleiden... Vor allem muß man den Eingeborenen erziehen und unterweisen, nicht damit er dem Besitzer als passives Tier diene, sondern damit er ein wertvoller Mitarbeiter des weißen Mannes werde, ebenso Mensch wie er, fähiger als er selbst, auf der glühenden, afrikanischen Erde Reichtum hervorzubringen.“ Kurz: die Integralisten würden ihm nicht das Amt des Gouverneurs verliehen haben, auf das er Anrecht zu haben meinte; voller Stolz aber betrat er dort den gleichen Boden, atmete die gleiche Luft, wärmte sich an der gleichen Sonne, die auch Luís de Camões und Diogo do Couto genügten! Es sollte nicht lange dauern.
In der Metropole hatte es den Aufstand der Schiffe gegeben, die Repressionen waren schlimmer geworden, ein Trupp politischer Flüchtlinge kam auf dem Weg nach Timor zur Ilha de Moçambique, und „wie Diogo do Couto es für Camões tat“, rief der Großvater, um ihnen zu helfen, zu öffentlichen Spenden auf, mit seinem Namen, seiner Stellung und den Auszeichnungen auf dem Briefkopf. Er hatte das Pech, daß der Minister Vieira Machado soeben in der Kolonie zu Besuch war und ihn von dort sogleich nach Angola versetzte, in der Rangordnung zurückgestuft und mit der Verfügung, ihn in den entlegensten Bezirk des Kongodistrikts abzukommandieren.
Der Großvater versuchte noch, sich dem zu entziehen. Er meldete sich krank, verbrachte ein paar Monate, verstrickt in die Ränke der Kolonialisten im Café Paço, in Lissabon und verpulverte alles, was er hatte, und auch, was er nicht hatte, bei aufwendigen Diners und mit zahllosen Geliebten. Und auch bei anderen genügsameren Versuchen, zur Revolution aufzustacheln. Die Zeiten aber hatten sich geändert und mit ihnen die Freunde, die nicht im Gefängnis saßen oder sich im Exil befanden. Schließlich verschwanden alle zusammen mit dem Kapital, und so machte er sich auf in den Kongodistrikt, gebrochen schließlich und nun wirklich krank, dorthin, wo der Kannibalismus wiederaufflackerte. Er fand kaum Zeit, auf eine Anfrage der Geographischen Gesellschaft zu den Beulen im Schädel der Kannibalen zu antworten.
Sein ehemaliges Haus in Vilarandelo wurde verkauft, um einen Teil der Schulden abzubezahlen, die er zusammen mit einer um den Verstand gebrachten Witwe und einem halben Dutzend minderjähriger Kinder hinterließ. Das Haus war zu groß, niemand wollte es haben, und schließlich kaufte es die Regierung zum halben Preis, als Haus des Volkes. Nach dem 25. April wurde daraus ein Bürgerzentrum mit einem Kino. Besser so.
Dieser autobiografische Roman liefert ein Bild der portugiesischen Diktatur vor ihrem Untergang und eröffnet eine Sicht auf das Problem der Kolonisierung im allgemeinen. Der Leser erlebt hautnah den Übergang der ehemaligen Kolonien zu den neuen afrikanischen Ländern.
In Südafrika geboren, wächst der Erzähler in Mosambik auf. In den Kolonien führen die portugiesischen Verwalter häufig eine Willkürherrschaft: Einer von ihnen richtet seine häuslichen Untergebenen beim Servieren zu Duetten aus Carmen oder Tosca ab. Gelingt es den Eingeborenen nicht, ihn zufrieden zu stellen, läßt er sie auspeitschen.
Demgegenüber sorgt sich der Vater des Erzählers um eine nachhaltige Entwicklung der ihm anvertrauten Distrikte: Er läßt Straßen und Hospitäler bauen, kümmert sich um die vielen Leprakranken und gründet Schulen. Erst zum Studium wechselt der Sohn für längere Zeit nach Europa, durchstreift als Bohèmien Lissabon und beteiligt sich am Wahlkampf des oppositionellen Generals Humberto Delgado. Einem drohenden Zugriff durch die Geheimpolizei entzieht er sich durch die Flucht nach Südafrika und anschließend nach England. Er bereist Guinea-Bissau und die Kapverdischen Inseln kurz nach deren Unabhängigkeit und glaubt, mit diesen Aktionen über seinen Vater zu triumphieren.
Doch die Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten markiert nur den Beginn einer neuen Beziehung zwischen portugiesischer Kultur und afrikanischen Nationalismen. Schließlich muß der Erzähler erkennen, daß auch er selbst von seinen afrikanischen Freunden als Teil der früheren Besatzungsmacht aufgefaßt wird - ein Prozeß, der das reale Geschehen wie den Roman als unabgeschlossen erweist.
Helder Macedo: geb. 1935 in der Nähe von Johannesburg, lebte in Mosambik und Lissabon, seit 1960 in London, Romancier, Essayist und Lyriker, von 1982 bis 2004 Inhaber des Lehrstuhls Camões für Portugiesische Literatur am King’s College
Mit Mozart in den Kolonialkrieg
von Peter Koj, Buch des Monats, August 2011, Portugiesisch-Hanseatische Gesellschaft Hamburg
Weiße Flecken von Afrika: Eine Spurensuche in verschwundenen Kolonien und einer verpufften Diktatur
Ralf Julke, L-IZ
⇒ www.l-iz.de/Bildung/Bücher/2011/01/Weisse-Flecken-von-Afrika-Eine-Spurensuche.html
Helder Macedo im Gespräch (mdr figaro):
- Teil 1 ⇒ l-lv.de/autoren/hoerproben/2011_05_23_Macedo_Afrika_1_mdr.mp3
- Teil 2 ⇒ l-lv.de/autoren/hoerproben/2011_05_23_Macedo_Afrika_2_mdr.mp3
Leseprobe:
DIE AUTORITÄT, DAS KINO UND DIE FOLGEN VON LAUNEN
Wenn die Zukunft die Vergangenheit auch unvermeidlich hervorbringt, so verträgt sich die Vergangenheit, ehe man weiß, was sie ist, mit derart geschichtlicher Vorherbestimmung doch schlecht und kann lediglich eine Frage von Verstimmung sein, wie bei Onkel Pedro während des Besuchs von Senhor Tomás Vieira.
Onkel Pedro war damals Sekretär meines republikanischen Großvaters, und Senhor Tomás Vieira lebte vom Kino, oder vielmehr, er zeigte Filme. Er war ungeheuer schlank; in den zwanziger Jahren war er Schauspieler beim Stummfilm gewesen, nach Mosambik emigriert, wo er sich einen gepanzerten Lastwagen anschaffte und die Aufführungen, à la Hanswurst, mit einem Stepptanz in riesigen Schuhen begann, von der Musik eines Grammophons begleitet. Er fuhr überall hin, wo man ihn rief, manchmal auch, ohne daß man ihn gerufen hätte, und stets war es ein großes Trara. Ihm habe ich meinen ersten Film zu verdanken, Der Kapitän der Wolken. Sofort wollte ich Pilot werden: ich stellte einen Stuhl vor den anderen, der Hund als Kopilot auf dem hinteren Sitz, und so beschossen wir die Deutschen mit dem Maschinengewehr. Tomás Vieira starb 1979 völlig vergessen in Lissabon, als ich gerade zum Staatssekretär für Kultur ernannt worden war. Niemand begriff, welche finsteren politischen Absichten mich dazu bewegten, zu seinem Begräbnis zu gehen.
Der Großvater war nach Ende des Ersten Weltkriegs in den Verwaltungsstab aufgerückt und befand sich als Kommissar für die Eingeborenenpolitik in Ressano Garcia. Der Grenze zu Südafrika wegen war es ein besonders heikler Auftrag. Die Sache mit Delagoa Bay war noch heiß, die Erinnerung an das Ultimatum noch frisch. Der Krieg und die diplomatischen Bemühungen der Republik hätten die portugiesischen Kolonien zwar gerettet, doch gab es gleichfalls das Abkommen, im Austausch gegen die Eisenbahn und den Hafen von Lourenço Marques Arbeitskräfte zu den Minen in Rand zu exportieren. Nach dem Waffenstillstand war England erneut ein notwendiges Übel geworden, doch schamlos und zynisch, wie es nun einmal war, konnte man ihm, wie zu Guerra Junqeiros Zeiten, nicht trauen. In Lissabon hatte der Großvater in seiner Jugend Prozessionen gestört, er war ein Freund von Magalhães Lima gewesen, und durch ihn ist er, glaube ich, Freimaurer geworden; er kämpfte gegen die Truppen von Lettows im Norden von Mosambik, verlor im Gefecht bei Negamano das rechte Auge, meldete sich, sobald er es konnte, beim Roten Kreuz und war bereits an der Seite von Massano de Amorim in der Offensive von Angoche; er nahm „Brito Camacho brüderlich in den Arm“, als der als Hoher Kommissar eintraf, und schien nun, geschützt durch sein Kriegsverdienstkreuz, das Malteserkreuz und das Kreuz des Christusordens, den Regimewechsel in der Hauptstadt überstanden zu haben. Seine Schuld war es nicht, wenn die Engländer uns übers Ohr hauten.
Ein Beispiel:
Ein umherziehender Sklavenhändler hatte versucht, den Häuptling einer mehr zu der Grenze hin gelegenen Gegend mit ein paar Stücken goldenen Pfunds abspenstig zu machen. Da der Häuptling – „ja, der war ein wirklicher Portugiese!“ – sich jedoch widersetzte, ließ er ihm die Strohhütte anzünden, um ihn gefügig zu machen, wenn er das nächste Mal mit dem Geld käme. Der Fall war ernst, denn hätte der Häuptling gesagt, der anderen Seite anzugehören, wäre die portugiesische Souveränität über jenen entlegenen Spitzteil des Territoriums nur schwer zu beweisen gewesen. Der Großvater las seine Geschichtsschreiber wieder, dachte an König Dom João II und den Marquês de Pombal , lud den Sklavenhändler zu einem opulenten Frühstück ein und gratulierte ihm dazu, den Häuptling an den ihm gebührenden Platz gestellt zu haben. Dies freilich reiche nicht aus, nötig sei vielmehr eine Demonstration militärischer Stärke. In der Gewißheit, daß niemand auch nur im Entferntesten etwas von seinen wahren Vorsätzen ahnte und eine desaströse, ungerechtfertigte Militärintervention diesen eher nutzte, war der Sklavenhändler mit dem Vorschlag sofort einverstanden und übertrug die Einzelheiten seiner eigenen Perfidie auf den Häuptling: „ein Bandit in den Diensten der Engländer, ein Befürworter der Sklaverei, der uns Bewohner und Land rauben will“. „Wenn dem so ist, verdient er den Tod!“ Wäre er, der Händler, bereit, die notwendigen vertraulichen Anweisungen gleich mitzunehmen und sie mit eigenen Händen zu übergeben, um Wort für Wort alles zu erklären, was er wußte? Aber selbstverständlich. Die Anweisungen wurden in seiner Gegenwart mit lauter Stimme niedergeschrieben, und er selbst half, die Petschaft dem Siegellack aufzudrücken. Nur daß die Anweisungen, die er in einem zuvor ausgestellten, identischen Umschlag mitnahm, den Verrat des Überbringers erklärten und in gedrängter Form endeten: „Man beseitige ihn“. Es war die Geschichte, die die Witwe, schon in Jahren fortgeschrittener Sklerose, am liebsten erzählte. „Aber Mama, willst du damit sagen, daß der Papa befahl, einen Menschen zu töten?“ „Aber ja, meine Tochter, er besaß doch die Macht dazu und noch zu ganz anderen Dingen!“
Ganz sicher besaß er die Macht, um Senhor Tomás Vieira kommen zu lassen. Der Grund für das Ereignis war Onkel Pedros Charakter. Der war in eine „hübsche, anmutige Eingeborene“ verliebt, „schlau wie alle aus ihrer Rasse, doch sehr hellfarbig“, die ihm den Kopf verdreht hatte, ohne Ehe jedoch nichts gewährte. In ideologischer Hinsicht hatte der Großvater dagegen nichts einzuwenden, Ehrenwort eines Demokraten!, der Junge, ein bißchen schüchtern, aber ginge am Ende noch in die Falle, mit tiefen Ringen unter den Augen und maulend schlich er umher, zwei oder dreimal schon hatte er sich in romantischen Umschreibungen verheddert, die nur Heiratsabsichten bedeuten konnten. Es war nötig, ihm eine Hilfe in die richtige Richtung zu geben: eine Kinovorstellung! Preiswertes Essen und Wein, die Lichter während der Vorführung gelöscht, danach Tanz im großen Salon, das Mädchen bei so vielen neuen Eindrücken in der richtigen Stimmung, Pedro endlich im Angriff, und alles in einer Nacht abgemacht. Der Plan hierzu wurde mit demselben strategischen Eifer umgesetzt, der dem Sklavenhändler gegolten hatte, und einen Monat später bereits war Senhor Tomás Vieira mit Rudolf Valentino zur Stelle, per Telegraph durch rigorose Ausführungen über die Aufteilung der reservierten Plätze in Kenntnis gesetzt: im Mittelpunkt ein Sessel mit einem stattlichen Schild an der Rückenlehne, auf dem in Großbuchstaben AUTORITÄT zu lesen stand; gleich links daneben, unter dem wohlwollenden Blick der Autorität, Onkel Pedro; und vor ihnen das Mädchen. Das begann während des Abendessens der sich dort abzeichnenden Zukunft entgegenzulächeln, sah diese Zukunft in der Platzreservierung für den Film bestätigt und entfernte während der Tanzvorstellung das Haar aus dem Genick, zeigte, als sie sich bückte, um während der Vorführung des Weißen Scheichs... eine Träne zu trocknen, etwas mehr von ihrem anmutigen Nacken, und Pedro: nichts! Worauf der Großvater, um ihm rein didaktisch zu zeigen, was in solchen Umständen zu tun sei, und ihm pragmatisch beizustehen, den Schnurrbart und den übrigen Bart zurückstrich, sich majestätisch nach vorn beugte und jenem kleinen Nacken, der dies schon so lange begehrte, seine eigene Hommage darbrachte. Und nach vorne gebeugt, ließ der es zu, von diesen Lippen wieder und wieder beehrt zu werden, von denen er annahm, es seien die Onkel Pedros (oder nicht?), bis die Lichter im Saal endgültig angingen. Nur daß Onkel Pedro sich eben weigerte, zum Tanz zu gehen, und es ganz und gar nicht lustig fand, so sehr der Großvater ihm am folgenden Tag das Witzige daran auch nahebringen wollte – „wenn sie die Lippen des Kommissars nicht von meinen zu unterscheiden weiß...“ –, und sich wenig später entschloß, nach Portugal zurückzukehren, wo er das tugendhafteste Mädchen der Christenheit und aus ganz Torre de Moncorvo heiratete. Beim Abschied riß der Großvater in einer charakteristischen, noblen wie sentimentalen Geste einen Brillantring vom Finger und reichte ihn ihm vor der letzten Umarmung: „Sei glücklich, mein Junge! Ich wollte dein Bestes!“
Die ferne, in Trás-os-Montes vollzogene Hochzeit jedoch sollte nicht die einzige sein, die von Senhor Tomás Vieira inspiriert wurde. Der jüngere Bruder, dem dieser künftige Onkel das niemals gebührend anerkannte Privileg schuldete, einmal mein Onkel zu werden, war unter dem unwahrscheinlichen Vorwand, den Film anzusehen, einen ganzen Tag von Lourenço Marques aus unterwegs gewesen, in Wirklichkeit aber, um zu sehen, was aus der Tochter des Kommissars geworden war. Die war soeben aus Odivelas zurückgekehrt, und er hatte nie das rothaarige Mädchen vergessen, das vor einigen Jahren dorthin abgereist war. Was er sah, gefiel ihm, sie heirateten, sie mit siebzehn, er mit zweiundzwanzig. „Ein schöner Junge mit einer großen Zukunft“, wie der Großvater in Gegenwart seiner liebsten Tochter mehrfach gesagt hatte, zufällig, als spräche er zu allen außer ihr. Da man die großväterlichen Schliche nun etwas besser kennt, stellt sich die Frage, ob der wahre Vorsatz der Einladung an Senhor Tomás Vieira am Ende nur das Wohl Onkel Pedros gewesen ist.
Der Großvater lernte seinen ersten Enkel noch kennen, ehe er zur Ilha de Moçambique und damit zum Höhepunkt seiner Macht weiterzog. Zum Verwalter ernannt, richtete er sich in dem noblen Renaissancepalast ein, als hätte er die Räume nach seinen Maßen in Auftrag gegeben: ein privater Kai, eine Rikscha, ein prächtiger indo-portugiesischer Thron, der jedes Wort überflüssig machte, das Autorität bedeutete. Sogar einen Fisch gab es dort, den man „Intendantur“ nannte, da er einen rötlichen Bart besaß, der seinem glich. Ein absoluter Despot. Von der aufgeklärten Sorte allerdings: er haßte die Jesuiten (für ihn waren das alle Pater) und versuchte, für alle Kinder des Distrikts die Schulpflicht einzuführen, „ohne Einschränkungen der Rasse und einschließlich der Mädchen, die die Mütter des künftigen Fortschritts“ seien. Das Projekt wurde als unrealistisch erachtet, und selbst wenn man es anders eingeschätzt hätte, so hätte es doch keine Priorität besessen, und die Prioritäten wurden ihm von dem Gouverneur diktiert. Er antwortete in einem amtlichen Schreiben, Mouzinho paraphrasierend, der, „obwohl Anhänger der Monarchie, ein Mensch war“: „Ich habe um Schulen ersucht, nicht um Ratschläge“. Und so war sein größter Beitrag eine aktive Beteiligung daran, daß die Mädchen der Insel, und zwar ohne Unterschiede der Rasse, künftige Mütter wurden, als er dort de facto das feudale Recht der ersten Nacht wiedereinführte, was seine jakobinische Ideologie de jure bis zum letzten Blutstropfen bekämpft hätte.
In einem öffentlichen Angriff jedoch auf „diese Hostienlutscher, die nun an der Macht waren“, zitierte er das Programm von Brito Camacho, „des guten Freunds, der zu einem verehrten Meister geworden war“: „Man muß die Eingeborenenfrau, eine Sklavin des Vaters, der Geschwister, des Ehemanns, emanzipieren und darf dabei nicht vergessen, daß ihr Schoß die fons vitae ist, in der die zukünftigen Arbeiter gezeugt werden. Man muß den Eingeborenen kleiden... Vor allem muß man den Eingeborenen erziehen und unterweisen, nicht damit er dem Besitzer als passives Tier diene, sondern damit er ein wertvoller Mitarbeiter des weißen Mannes werde, ebenso Mensch wie er, fähiger als er selbst, auf der glühenden, afrikanischen Erde Reichtum hervorzubringen.“ Kurz: die Integralisten würden ihm nicht das Amt des Gouverneurs verliehen haben, auf das er Anrecht zu haben meinte; voller Stolz aber betrat er dort den gleichen Boden, atmete die gleiche Luft, wärmte sich an der gleichen Sonne, die auch Luís de Camões und Diogo do Couto genügten! Es sollte nicht lange dauern.
In der Metropole hatte es den Aufstand der Schiffe gegeben, die Repressionen waren schlimmer geworden, ein Trupp politischer Flüchtlinge kam auf dem Weg nach Timor zur Ilha de Moçambique, und „wie Diogo do Couto es für Camões tat“, rief der Großvater, um ihnen zu helfen, zu öffentlichen Spenden auf, mit seinem Namen, seiner Stellung und den Auszeichnungen auf dem Briefkopf. Er hatte das Pech, daß der Minister Vieira Machado soeben in der Kolonie zu Besuch war und ihn von dort sogleich nach Angola versetzte, in der Rangordnung zurückgestuft und mit der Verfügung, ihn in den entlegensten Bezirk des Kongodistrikts abzukommandieren.
Der Großvater versuchte noch, sich dem zu entziehen. Er meldete sich krank, verbrachte ein paar Monate, verstrickt in die Ränke der Kolonialisten im Café Paço, in Lissabon und verpulverte alles, was er hatte, und auch, was er nicht hatte, bei aufwendigen Diners und mit zahllosen Geliebten. Und auch bei anderen genügsameren Versuchen, zur Revolution aufzustacheln. Die Zeiten aber hatten sich geändert und mit ihnen die Freunde, die nicht im Gefängnis saßen oder sich im Exil befanden. Schließlich verschwanden alle zusammen mit dem Kapital, und so machte er sich auf in den Kongodistrikt, gebrochen schließlich und nun wirklich krank, dorthin, wo der Kannibalismus wiederaufflackerte. Er fand kaum Zeit, auf eine Anfrage der Geographischen Gesellschaft zu den Beulen im Schädel der Kannibalen zu antworten.
Sein ehemaliges Haus in Vilarandelo wurde verkauft, um einen Teil der Schulden abzubezahlen, die er zusammen mit einer um den Verstand gebrachten Witwe und einem halben Dutzend minderjähriger Kinder hinterließ. Das Haus war zu groß, niemand wollte es haben, und schließlich kaufte es die Regierung zum halben Preis, als Haus des Volkes. Nach dem 25. April wurde daraus ein Bürgerzentrum mit einem Kino. Besser so.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Autor.