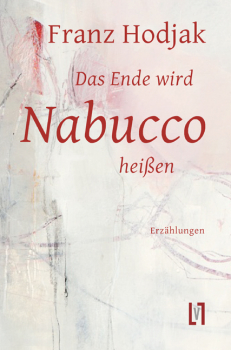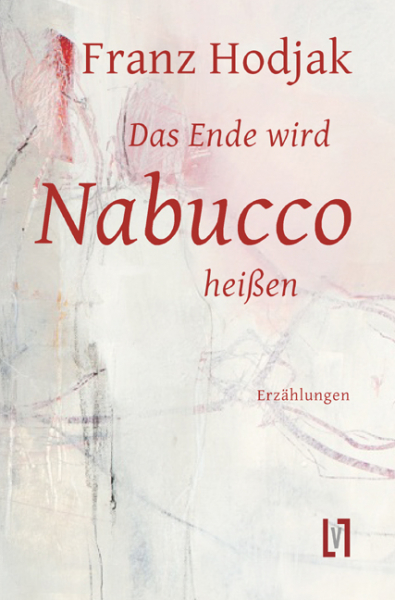



170 S., Festeinband, Umschlagbild: Astrid Hodjak
Das Leben, die Freuden, Träume, Hoffnungen und Sorgen des kleinen Mannes ziehen sich als Leitmotiv durch die Erzählungen dieses Bandes. Seine Protagonisten zeichnen sich durch die Unbeschwertheit des Taugenichts aus. Zuweilen nimmt die Erzählung jedoch
eine kafkaeske Wendung.
Franz Hodjak fragt nach dem Ort der Heimat oder der Heimatlosigkeit im Sinne eines modernen Nomadentums. Es hat nicht nur für den in Rumänien geborenen, jetzt in Deutschland lebenden Autor in biographischer Hinsicht Bedeutung, sondern charakterisiert eine ganze Generation vom Exodus betroffener Rumäniendeutscher. Auf den Erfahrungsschatz einer zweifachen Staatsangehörigkeit zurückgreifend, berichten etliche Erzählungen sowohl von der schwierigen Beziehung zwischen Obrigkeit und Einzelnem im ehemals kommunistischen Rumänien als auch vom bürokratisiertem Alltag im heutigen Deutschland. Es sind die leisen, unaufgeregten Töne, mit denen Franz Hodjaks neuer Erzählband seine Leser gewinnt.
Franz Hodjak: Geboren 1944 in Hermannstadt (Rumänien). Nach seinem Abitur war er beim Militär, danach verdiente er sein Geld als Hilfsarbeiter und studierte dann Germanistik und Rumänistik. 1970-1992 arbeitete er als Lektor für deutschsprachige Bücher im Dacia Verlag in Klausenburg. 1992 übersiedelte er nach Deutschland und lebt heute als freier Schriftsteller in Usingen.
Auszeichnungen (Auswahl): 1990 Georg-Maurer-Preis Leipzig, 1990 Preis des Landes Kärnten beim Ingeborg-Bachmann-Preis, 1991 Literatur-Förderpreis des Kulturkreises im BDI, 1992 Ehrengabe zum Andreas-Gryphius-Preis, 1993 Frankfurter Poetik-Vorlesungen, 1996 Nikolaus-Lenau-Preis der Künstlergilde Esslingen, 2005 Kester-Haeusler-Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung, 2013 Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturpreis
Besprechung von Hanne Kulessa im Rahmen der Sendung "Kulturfrühstück" auf hr2:
www.hr-online.de/website/radio/hr2/index.jsp;jsessionid=8FF1D521BB06236103405DDC66EA3F84
Rezension von Axel Helbig, DNN vom 9. 4. 2014
Franz Hodjaks Figuren sind mit einem freisinnigen Charakter und weiten Seelen ausgestattet. Mitunter erinnern sie an Märchenfiguren, die skurrile und absurde Abenteuer zu bestehen haben, um endlich ihr Glück finden zu können. Andererseits sind diese Figuren eng mit dem Leben verbunden und ein Spiegel der Sehnsüchte und Versagensängste des durchschnittlichen Europäers von heute.
Der jetzt im Leipziger Literaturverlag erschienene Erzählungsband „Das Ende wird Nabucco heißen“ versammelt sechzehn Fiktionen, die knapp neben der Wirklichkeit angesiedelt sind. Diese kleine Differenz ist es aber, durch welche sich Hodjaks Figuren unvergesslich einprägen. Stets ist es eine besondere Eigenschaft oder ein ausgewählter Eigensinn, der diese Menschen von der breiten Masse abhebt, sie isoliert und in ein Nachdenken über die Philosophie der Freiheit zwingt.
Jeremias, ein ehemaliger Lehrer, hat seinen Rentnerwohnsitz in die Züge des Regionalverkehrs verlegt. „Notorische Sesshaftigkeit“, behauptet er, „führe zwangsläufig zu Apathie, schließlich zu akutem Lebensüberdruss, und so sei es auch nicht verwunderlich, dass kein Mensch mehr ohne Psychiater auskommen könne.“
Sankt-Pauli, ein begnadeter Taschendieb, der selbst die abgebrühtesten Berufsverbrecher im Zentralgefängnis ob seiner Fähigkeiten in Erstaunen versetzen kann, wird dank deren Verbindungen ein „ehrlicher Taschendieb“ und gefeierter Medienstar.
Der sture Herr Beckermann lebt im erzkatholischen Dreipfeifen. Ein Kirchenaustritt isoliert ihn, denn von da an sei es, nach Ansicht der Dreipfeifener, „nur noch ein kleiner Schritt bis zu terroristischen Anwandlungen oder zumindest wertezerstörenden Umtrieben“.
Immer wieder gelingt es Hodjak, mit den Lesererwartungen zu spielen und seinen Geschichten eine unerwartete Wendung zu geben. In Die Pension wird ein Urlaub zum kafkaesken Horrortrip. In Sylvester verursacht ein Schnee- und Verkehrschaos eine anarchisch-dionysische Liebesfeier in einem Wartesaal der Regionalbahn.
In der Titelgeschichte Das Ende wird Nabucco heißen hat der Protagonist wie Kafkas Landvermesser eine Folge von grotesken Abenteuern zu bestehen. Auf die Polizeistation eines Dorfes gerufen, um einen Kühlschrank und eine Rechenmaschine zu reparieren, gerät er per Autostopp auf die Ladefläche eines offenen Sargmöbeltransporters. Die Idee, sich in einem der Särge vor dem Regen zu schützen, löst eine Kette von absurden Geschehnissen aus, die ihn hinfort veranlassen, „sich gründlich mit dem Tod zu beschäftigen“.
Leseprobe:
Vater und Sohn
Eine leichte Fröhlichkeit, eine Art schwebende Genugtuung erfüllten Feri an diesem Morgen mit einem wohligen Gefühl der Schwerelosigkeit, und er wunderte sich, daß sein Körper noch im Bett lag und nicht etwa an der Zimmerdecke klebte, ins All drängend. Er betrachtete seinen fünfjährigen Sohn, der ruhig atmend neben ihm schlief, und er war froh, daß sich sein Körper bloß so anfühlte, als wäre er schwerelos, denn wäre er es tatsächlich gewesen, wäre er längst davon geschwebt und hätte den Sohn allein zurückgelassen. Feri war stolz auf seinen Sohn, weil dieser den schillernden, überall lauernden Verlockungen, ein Dieb zu werden, ein Straßenkind, ein Bettler oder dergleichen, widerstanden hatte. Er war stolz, weil sein Sohn nur wenig zum Glück brauchte, genau wie er, der wußte, daß man nur wirklich frei sein konnte, wenn man wenig zum Glück brauchte. Dieser Tag aber war ein besonders guter Tag, es gab gleich vier Beerdigungen.
Feris Frau hatte eines Abends, nachdem der Sohn zu Bett gegangen war, ihre eher verborgene Seele voll und ganz vor ihm auf dem Küchentisch ausgebreitet. Feri, hatte sie gesagt, ich komme mir schon seit geraumer Zeit vor wie eine Kuh, ja, Feri, wie eine Kuh, die auf dem Heimweg lange vor dem Tor stehen bleibt und nicht weiß, ob sie eintreten soll, weil ihr dahinter alles so fremd erscheint. Sie spüre dann, meinte sie, nervös an der Tischdecke zupfend, wie ihr Sohn heftig an einem Strick zöge, an dessen anderem Ende sie angebunden sei, und nur deshalb trete sie ein. Dieses verdammte Dorf, in dem sich stets nur wiederhole, was nicht passiere, sei ihr zu eng geworden. Auch der Sohn würde über kurz oder lang daran zugrunde gehen, wenn er sich nicht mehr richtig auf die Welt konzentrieren könne, sondern bloß auf dieses Seil in der Welt. Es sei deshalb das Beste, wenn sie ginge. Feri blieb ruhig. Er hatte ja damit gerechnet. Die wiederholten Warnungen seiner Kumpels, eine Frau zu nehmen, deren Vater jünger war als er, hatte er frohen Mutes in den Wind geschlagen, weil er sich unverstanden fühlte. Er wußte ja selbst, daß sie eines Tages gehen würde, doch für ihn war unvergleichlich wichtiger, eine schöne Zeit mit einer sehr jungen, hübschen Frau an seiner Seite erleben und genießen zu können. Wie lange diese Zeit dann dauern würde, war ihm letztlich schnuppe, es war im Grunde eine belanglose Nebensache. Und so kam es für ihn überhaupt nicht überraschend, was sie da sagte. Er hatte volles Verständnis dafür. Er hätte auch volles Verständnis dafür gehabt, wenn sie etwas anderes gesagt hätte. Noch in der gleichen Nacht war sie dann abgehauen.
Feri betrachtete noch eine Weile seinen schlafenden Sohn, dann stand er leise auf, obwohl es sehr früh war und er noch genügend Zeit gehabt hätte, im Bett liegen zu bleiben und zu träumen. Doch heute war ein besonderer Tag. Er ging in den Hof, um zu duschen. Es war Sommer. Im Hof stand auf drei Pfeilern eine mit Wasser gefüllte Tonne, an der ein Schlauch mit Wasserhahn und mit der Brause einer Gießkanne angebracht war. Im Winter mußte er Wasser auf dem Küchenherd wärmen und sich an einem Waschgestell waschen, das seit vielen Generationen von einer auf die andere vererbt wurde. Doch jetzt war Sommer, und es herrschte eine Hitze, wie es sie schon lange nicht mehr gegeben hatte. Bei einer solchen Hundshitze ließ man alle Tätigkeiten ruhen, da jeder Handgriff, egal wie sehr man sich anstrengte, meist daneben ging, auch die wichtigen Entscheidungen wurden hinausgeschoben, weil sogar das Denken keuchte und schwitzte, im Grunde ging gar nichts mehr bei einer solchen Hundshitze, nur das Sterben machte eine Ausnahme. Die Dusche im Hof war eine Neuanschaffung, die Feri seiner Frau zur Hochzeit geschenkt hatte. Als er noch verliebt war, hatte er oft auch im Winter bei eisiger Kälte im Hof geduscht. Einmal hatte er seine Frau sogar zum Geschlechtsverkehr im Schnee überzeugen können, das war allerdings hinten im Hof, am Fluß, der dort vorbeiführte.
Feri war nie in Eile, das durfte er auch gar nicht, weil er an Asthma erkrankt war, das er, weil alle anderen Versuche fehlgeschlagen hatten, neuerdings von der berühmten Baba Rumba, einer in der ganzen Gegend hoch geschätzten, uralten Vettel behandeln ließ. Mittels verschiedener Säfte, die sie aus geheimen Kräutern destillierte, rückte sie dem Übel zu Leibe. Und das mit einigem Erfolg. Zur heilenden Prozedur gehörten allerdings auch seltsame Praktiken und Rituale, die den Kräuterkuren erst so richtig zu Wirkung und Nachhaltigkeit verhelfen sollten. Asthmakranke wie Feri, zum Beispiel, mußten drei mal über Baba Rumbas Schwelle treten, auf die sie ein scharfes Messer, einen Spiegel und bunte Kreide legte. Man munkelte zwar, diese Baba Rumba sei mit dem Teufel im Bund, doch wer ließ sich nicht gern auch in einen unerlaubten Bund hineinziehen, wenn das nur half. Jedenfalls konnte Feri wieder freier atmen, und frei atmen zu können, sagte er sich, sei die Grundvoraussetzung für jede Art von Freiheit. Und da er nichts Besonderes zu tun hatte, ließ er sich auch viel Zeit bei der Morgentoilette. Für ihn war Sauberkeit das oberste Gebot, doch nicht in streng egoistischem Sinn, wie er immer wieder zu betonen wußte. Sauberkeit sei nicht so sehr eine Frage der eigenen Körperhygiene, sondern vielmehr ein Problem des Respekts vor den Menschen, mit denen man verkehre, aber auch ein Problem des Respekts vor den Menschen, mit denen man eher aus Zufall in Kontakt kommen könnte. Denn das einzige Alibi, das wahrlich nichts tauge, meinte Feri stets erbost, sei zweifelsohne der Zufall. Deshalb rasierte er sich auch jeden Morgen frisch und schnitt sorgfältig die hervorquellenden Haare aus Nasenlöchern und Ohren. Allein auf den ungewöhnlich dichten, langen Haarwuchs auf Brust und Beinen war er stolz, obwohl er wußte, daß so mancher im Dorf dies zum Anlaß nahm, hinter vorgehaltener Hand spöttisch zu behaupten, das sei schließlich ein klarer Beweis dafür, daß er, Feri, vom Affen abstamme. Doch Feri ließ sich niemals aus der Fassung bringen, wußte er doch, daß auch er wie alle anderen von Gott geschaffen wurde und daß das Ganze bloß ein dummes Gerede von Neidern war. Auch den tiefschwarzen Schnurbart, der schmal wie eine dünne Schnur ausgerichtet war, justierte er jeden Tag millimetergenau aufs neue. Die Jacketts, Krawatten und Hosen, die er trug, waren zwar alt und stammten zum Großteil noch aus der Garderobe seines Vaters oder Großvaters, aber sie waren immer sauber, gebügelt und gepflegt, und er meinte stets scherzend, er trage sie eben so lange, bis sie wieder in Mode kämen.
Als Feri seinen Sohn endlich weckte, sprang dieser erschrocken auf und wollte gleich in seine Kleider fahren. Feri beruhigte ihn, indem er ihm versicherte, es sei noch genügend Zeit, diese ganze Hektik habe keinen Sinn, Hektik verderbe nur den Charakter und die Umgangsformen. Zuerst müsse er ordentlich duschen und dann frische Kleider anziehen, die er auf dem Stuhl für ihn schon bereit gelegt habe. Der Sohn blickte Feri mißtrauisch an. Was ihn so sehr treibe und verunsichere, gestand er, sei die Angst, daß sie sich bei den Beerdigungen verspäten könnten. Es könnte ja gut sein, daß sie auch früher begännen, fügte er unsicher, etwas stockend hinzu. Wieder beruhigte Feri seinen Sohn. Nein, das sei unmöglich, erklärte er. Wenngleich schon nichts mehr richtig funktioniere, redete er auf seinen Sohn ein, und alles irgendwie aus den Fugen geraten sei, sei doch etwas in diesem Chaos übriggeblieben, das noch ordnungsgemäß vonstatten ginge. Der Aberglaube säße viel zu tief, als daß man sich erlaubte, auch mit Beerdingungen gewissenlos und schlampig umzugehen. Wenn man noch irgendwo auf Ordnung und Pünktlichkeit Gewicht lege, dann zumindest bei den Beerdigungen, als einem letzten Rest von Respekt sozusagen. Man habe dem Verstorbenen im Leben genug Schmach und Schande zugefügt, als daß man es auf sich nehmen wolle, sich auch noch im Tod an ihm zu versündigen. Außerdem sei der Fußweg in die Stadt doch bloß zwei knappe Stunden, und bis zur ersten Beerdigung seien es noch geschlagene vier Stunden.
Der Weg zur Stadt führte ein beträchtliches Stück durch einen Mischwald, in dem sich Feri mit seinem Sohn gern aufhielt, weil er großes Gewicht darauf legte, daß sein Sohn schon früh den Reichtum an Pflanzen und Tieren in Wald, Wiese und Flußauen kennen lernte und mit ihm vertraut würde. Feri konnte einundzwanzig Vogelstimmen nachahmen, sein Sohn schon sieben. Auch im Nachahmen des Röhrens der Hirsche in der Brunftzeit machte er erhebliche Fortschritte. Sein Sohn war ebenso ein guter, dankbarer Schüler in Sachen Insekten, Pflanzen, Pilzen und Moosen. Das Lernen bereitete ihm große Freude, besonders wenn sein Vater ihn unterrichtete. Er wußte schon genauestens Bescheid, welch hervorragende Architekten die Ameisen und Biber waren und welch raffiniert ausgeklügelte Techniken sie bei der Errichtung ihres komplizierten Baus einsetzten. Sogar die Bewegungen der verschiedenen Fischarten mit dem Maul konnte er schon recht gut nachmachen, und das war beileibe nicht leicht, weil es da kaum sichtbare, jedoch erhebliche Unterschiede gab. Seinen Vater zum Angeln zu begleiten, machte ihm vor allem deshalb besonders Spaß, weil man beim Angeln ganz leise sein mußte und nicht streiten durfte. Auch das Klettern auf Bäume beherrschte er zufriedenstellend. Doch immer, wenn Feris Sohn gefragt wurde, was er denn später werden wolle, antwortete dieser, ohne auch nur mit den Wimpern zu zucken, er werde Kutscher in Wien und werde in elegantem Frack und Zylinder der Kundschaft aus aller Welt die Geschichte der Stadt erklären. Sobald Feri solches hörte, schüttelte er jedes Mal nur den Kopf und meinte, Sohn, Sohn, du liest einfach zu viele Märchen, die machen dich bloß verrückt. Und wenn der Sohn nicht aufhörte, von der Geschichte Wiens zu schwärmen, unterbrach Feri ihn stets mit den Worten, du solltest besser Pope in Burdujeni werden, dann bist du niemals allein. Du wirst viele Freunde haben, die Leute werden aufschauen zu dir, und die Frau wird dir nicht davonlaufen. Der Rest ist vergänglich. Nur Gott im Himmel wird es immer geben, weil die Menschen immer Angst haben werden, nicht zu glauben. Die Zukunft liegt in sicheren Händen, wenn du Pope wirst.
Während nun Feri gerade im Begriff war, seinem Sohn zu erklären, welche Bewandtnis es mit der verheerenden Plage der Borkenkäfern auf sich hatte, fuhren in einem offenen Cabriolet zwei junge Damen vorbei, die Feri und sein Sohn höflich grüßten. Die Damen, gut gelaunt, zeigten den beiden den Stinkefinger, wobei eine die grölende Musik noch lauter stellte und mitzusingen begann.
Feri fiel auf, daß sein Sohn sehr schweigsam geworden war, nachdem sie aus dem Wald getreten waren, es schien ihm, als grübelte er ernsthaft über irgend etwas nach. Auf seine Frage, woran er denn denke, gab der Sohn zu bedenken, wie schön es doch wäre, wenn alle Toten von der Welt in Klausenburg begraben würden. Feri horchte verwundert auf, so einen Wunsch hatte er von seinem Sohn nicht erwartet. Der Sohn rückte nur mühsam mit der Sprache heraus. Er meinte schließlich, es wäre deshalb so schön, wenn alle Toten von der Welt in Klausenburg beerdigt würden, weil sie sich dann jeden Tag göttlich satt essen könnten. Über derlei Überlegungen war Feri sichtlich empört und gereizt, doch er hielt sich zurück, versuchte, Ruhe zu bewahren. Das wäre ungerecht, erklärte er. Und woher überhaupt dieser Egoismus herkomme, von ihm sicher nicht. Das sei beschämend genug, mahnte Feri seinen Sohn. Überall auf der Welt, klärte er den Sohn weiter geduldig auf, gäbe es Arme, und wenn alle Toten in Klausenburg beerdigt würden, würde die Hungersnot nur noch größer werden, weil der Leichenschmaus überall dort fehlte, wo er dringend gebraucht werde. Sie, hier, hätten dann zwar in Hülle und Fülle zu essen, aber sie würden letzten Endes bloß den anderen das wegessen, was ihnen rechtmäßig zustünde. Gerechtigkeit gäbe es sowieso nur noch zwischen den Armen, und das sollte, bitte, auch so bleiben, denn wenn die Gerechtigkeit auch zwischen den Armen verschwände, sähe die Welt noch trauriger aus. Also sei es vor allem, schlußfolgerte Feri, eine Frage der Gerechtigkeit, daß die Toten weiterhin dort beerdigt werden sollten, wo sie auch gestorben seien, und nicht alle in Klausenburg. Ob er das verstanden habe, fragte er streng, dem Sohn tief in die Augen blickend. Dieser lief dunkelrot an im ganzen Gesicht. Die Röte lief blitzschnell den Hals hinunter und breitete sich aus auf Brust und Armen, wo sie große, glühende Flecken bildete. Ja, schämen konnte sich sein Sohn genau so schnell und gründlich wie lernen, und auch darauf war Feri stolz. Sofort versprach der Sohn seinem Vater, nie wieder im Leben auf solch habgierige, egoistische Gedanken zu kommen....
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
.jpg)