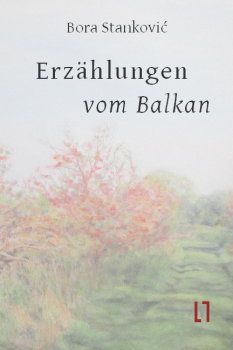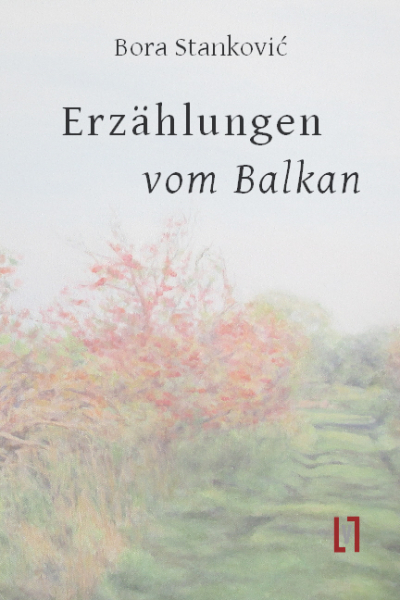





Ausgewählt, eingeleitet und aus dem Serbischen übersetzt von Robert Hodel
Festeinband
Bora Stankovic hat mit seiner ersten Erzählsammlung „wie ein Blitz in die Literatur eingeschlagen“, schrieb der führende Literaturkritiker Jovan Skerlic 1899, und 1902, als der zweite Erzählband herauskam, rief der Dichter Jovan Ducic begeistert aus: „Ich kenne nichts, das wärmer und reizender wäre, und dieser erregte Zustand der Seele, diese Leidenschaft, diese aufgewühlte Wärme, hält sich von der ersten bis zur letzten Zeile.“
Noch heute berühren Stankovics Geschichten zutiefst, lassen Liebe, Bangen, Mitleid und Sehnsucht erleben – es scheint, dass sich die menschliche Seele nicht in Zeiträumen verändert, die in Jahrhunderten gemessen werden.
Dieses Buch versammelt vierzehn Erzählungen und neunzehn Skizzen, die Stankovic von der Jahrhundertwende bis in die 1920er Jahre verfasst hat. Die ersten Geschichten spielen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als sich Serbiens Südosten vom Osmanischen Reich zu befreien beginnt, die späteren im Belgrad der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts.
Der Auswahl kanonischer Texte geht eine Einführung in das Leben und Werk des Schriftstellers voraus. Sie bietet einen Einblick in einen historischen Raum, der südslavische, westeuropäische und osmanische Einflüsse in sich vereinigt, und in eine Zeit, die in patriarchal-feudalen Besitzverhältnissen beginnt und mit dem Übergang in eine moderne europäische Gesellschaft endet.
Bora Stankovic: geb. 1876 (?) in Vranje, gest. 1927 in Belgrad, zählt zu den wichtigsten Autoren der serbischen Literatur. Sein Theaterstück Koštana ist das meistgespielte Drama des Landes und ist, wie der Roman Hadschi Gajka verheiratet sein Mädchen, mehrfach verfilmt und vertont worden. Seine Erzählungen gehören zu den ersten Prosatexten Europas, die eine offene Sinnlichkeit thematisieren. „Die Seiten, auf denen er die Macht der Leidenschaft beschreibt, sind wahrscheinlich die feurigsten, emotional intensivsten unserer gesamten Literatur.“ (Meša Selimovic)Robert Hodel: geb. 1959 in Buttisholz (Luzern), studierte Slavistik, Philosophie und Ethnologie in Bern, Sankt Petersburg und Novi Sad. Seit 1997 ist er Professor für Slavische Literaturwissenschaft an der Universität Hamburg.
In der Nacht
Cveta saß auf dem Acker und wartete auf ihren Mann Jovan, der Wasser für den Tabak zuleiten wollte. Sie hatten die Pflanzen letzte Woche gesetzt und noch immer waren sie nicht angegossen. Cveta kauerte, ihr Kinn lag auf den angezogenen Knien, sie blickte mit schläfrigen Augen in die warme, dunkle Nacht hinaus. Im Osten hoben sich die Umrisse der nahen Hügel und Bergkämme dunkel vom tiefroten Himmel ab, der Mond war noch nicht aufgegangen. Auf den bepflanzten, von Furchen durchzogenen Äckern arbeiteten in ihrer Nähe überall Menschen im Laternenlicht, und vor ihr, am Fluss und am Weg entlang, ragten hohe Pappeln und dichte Weiden empor, die lispelten und schwankten, als seien sie menschliche Gestalten... Hier und da war der dumpfe, metallene Klang einer Haue zu vernehmen, die heiseren Stimmen von Arbeitern, deren Zurufe der warme Wind, der leise durch die Ebene strich, sogleich wieder vertrug.Cveta war erschöpft und müde, kämpfte gegen den Schlaf, als sie plötzlich dumpfe Schritte hörte, die näherkamen. Schon bald erkannte sie die Stimme ihres Mannes.
„Hier!“, sagte er zu jemandem, „schau, Bruder, schon das ganze Jahr herrscht Trockenheit, kein Tropfen Wasser ist gefallen... Schau, wie welk alles ist, eine Sünde, nur schon hinzusehen... Da! Von zehn Setzlingen hat nicht einer Wurzeln geschlagen. Ein Elend, sag ich dir!...“
„Schon wahr! Schon wahr!“, erwiderte der andere.
„Gott!, wieder er?!“, schreckte Cveta auf, als sie die zweite, weiblich klingende Stimme erkannte. Sie erhob sich hastig, ergriff die Haue, lief, als würde sie fliehen, in den Acker und begann zu hacken. Jovan trat auf sie zu: „Du arbeitest?“ Er nahm die Haue von der Schulter, schlug sie in die Erde, legte die Laterne ab und setzte sich auf den Flurrand. „Komm her, Gazda Stojan, wandte er sich an seinen Begleiter, der ihm folgte, „komm, setz dich ein bisschen.“
„Gleich, gleich!“, ließ sich die andere Stimme vernehmen.
Mit unsicheren Schritten, von einer Furche in die nächste stolpernd, tauchte eine lange, schmächtige Gestalt auf, die ebenfalls eine Laterne und eine Haue trug. „Guten Abend! Ihr arbeitet?“, fragte er leise und irgendwie schüchtern.
Cveta grüßte nicht. Vielleicht war sie in die Arbeit vertieft und hatte ihn nicht gehört.
„So quälen wir uns ab, Herr, wie alle armen Schlucker“, gab ihm Jovan zur Antwort und rückte etwas zur Seite, um ihm Platz zu machen. „Setz dich. Ruh dich aus. Möchtest du etwas Tabak?“
„Ja, warum nicht!“ Und um sich blickend, setzte sich Stojan langsam hin, kreuzte die Beine, drehte den Tabak ein und begann hastig, ungeschickt, zu rauchen. Jovan führte seine Klage über die schlimmen Jahre, die schlechten Zeiten, die Gemeinde, die Müller und alle anderen fort, die verhinderten, dass ihm Wasser zugeteilt wurde. Stojan hörte zu, nickte zustimmend mit dem Kopf, rauchte, gab hier und da zerstreut Antwort. Wer weiß, wie lange es noch gedauert hätte, wenn Jovan nicht plötzlich aufgesprungen wäre, um sich über die Erde zu beugen: Er hörte, wie in der Ferne ein Wasserlauf rieselte und schlängelnd in ihre Richtung floss. Voller Freude warf er die Zigarette zu Boden, ergriff die Haue und rannte ohne Laterne dem Wasser entgegen.
„Cveta, mach die Furchen bereit“, rief er ihr zu, die weiter entfernt noch immer hackte. „Und du, Gazda, warte, ich komme gleich wieder... E-e-ej!“, rief er fröhlich und gedehnt und tauchte in die Dunkelheit ein.
Sein plötzliches Verschwinden schien Stojan zu erschrecken, denn auch er erhob sich, lief hinter ihm her, kam aber sogleich wieder zurück, setzte sich erneut und begann trockene Grashalme auszuzupfen. Er horchte auf Cvetas Schläge. Auf einmal legte er die Hand an den Mund und rief leise in ihre Richtung: „Cveta!“
Es kam keine Antwort, er vernahm nur das Schlagen der Haue.
„Cveta!“, rief er lauter.
Sie schwieg noch immer.
„Cveta, hörst du mich?“ Er beugte sich nach vorne, schärfte Ohren und Augen, sah, wie sie sich krümmte und so kräftig die Haue schlug, dass von den Steinen, auf die sie traf, die Funken sprühten. „Cveta, komm, oder...“ – er wollte sich erheben, fuhr jedoch jäh zurück, als er sah, dass sie auf ihn zulief. Sie beugte sich über ihn und fragte ihn gedämpft: „Warum bist du gekommen?“
„Ich?!“, erschauderte er und schluchzte. „Ich bin nicht..., glaub mir, ich bin nur, weißt du, auf den Acker gegangen, und da bin ich auf deinen Mann gestoßen, so... so sind wir zusammen... gekommen! Bist du mir böse?“
„Geh! Augenblicklich!“, gab sie zurück und wandte ihm zornig den Rücken zu.
„Du bist mir böse? Sei doch nicht so!“
„Ich bin dir nicht böse.“
Sie begann zu schlucken, als würde sie von Tränen überwältigt. „Ich bin dir nicht böse, aber was werden die Leute sagen! Geh, wenn du Gutes im Sinn hast. Was willst du? Ich bin verheiratet!“
„Das ist wahr“, antwortete er weich.
„Wenn es wahr ist, warum kommst du dann? Warum lässt du mich nicht in Ruhe...? Du hast doch Frau und Kinder.“
„Ach“, winkte er ab, „erinnere mich nicht daran“.
„Ja, das hast du, und ich? Es fehlt nur noch, dass er davon hört – wohin, wohin soll ich dann gehen?“
„Aber nicht doch, Cveta“, rief er, als er spürte, wie ihre Stimme zitterte und ihr Tränen aufstiegen. „Ich gehe. Gleich. Es stimmt, was du sagst, aber ich... Du kennst mich. Ich bin nur... ich bin gekommen, um dich zu sehen. Und wenn du…, wenn du wirklich willst, dass ich nicht mehr komme, dann will ich mich daran halten... Lebwohl!“
Sie reichte ihm nicht die Hand, wich zurück und sagte scharf: „Lebwohl. Geh.“
„Ech, du bist mir böse!“, antwortete er bestürzt, warf die Haue über die Schulter und ging.
Als er verschwunden war, wandte sie sich mit aller Kraft um, als müsste sie sich vor etwas schützen, ergriff ihre Hacke und flüsterte vor sich hin: „Er lügt, er lügt. Er kommt wieder. Och, und was sucht er?“ (Sie wusste es.) Warum lässt er sie nicht in Ruhe? Ihrem Mann darf sie nichts erzählen. Bei einem Temperament wie dem seinen könnte noch Blut fließen... Würden sie sich aber sehen, sich unterhalten, würde man sagen, er kommt zu ihr, ohne dass ihr Mann etwas davon weiß... Und wohin kommen dann ihre Seele und ihr Leib im Jenseits?... Eine Sünde ist es, eine Sünde... Mutter Gottes!“
Sie bekreuzigte sich, flüsterte ein Gebet! Doch diese warme Nacht, der dumpfe, metallene Klang der Haue und die Bewegungen menschlicher Schatten im Schein der düsteren Laternen wühlten sie auf, erfüllten sie mit Angst und süßer Erinnerung. Ihre Gedanken begannen wider alle Bekreuzigungen und Gebete zu schweifen und heraufzuholen, was einst war:
– – – – Sie war noch ein Kind gewesen, als ihre bedürftigen Eltern sie als Dienstbotin in Stojans Haus gaben. Man wollte sie auf diese Weise angemessen verheiraten. Doch Stojans Vater war ein schroffer und ungehobelter Mensch. Nach seinem finsteren, verschlossenen Gesicht zu urteilen, hatte keiner jemals ein zärtliches Wort von ihm vernommen. Er behandelte selbst seine Frau und sein einziges Kind, Stojan, wie Knechte. Alle fürchteten ihn, zitterten vor ihm. Und wäre nicht Stojans Mutter gewesen, eine warmherzige Frau, hätte wohl auch Cveta das Schicksal ihrer Genossinnen geteilt: Die Mägde reicher Häuser wurden von den Knechten missbraucht, manchmal sogar vom Gazda, oder bekamen so schwere Arbeit aufgebürdet, dass sie bald gebrochen und mutlos waren. Stojans Mutter gab auf sie acht, weil ihr Kind am liebsten mit ihr, Cveta, spielte. Sie schirmte sie von den Knechten ab und bürdete ihr keine schweren Lasten auf. So wuchs Cveta zu einem schönen, anmutigen Mädchen heran. Ihre Kraft und kernige Schönheit verzückten alle, und am meisten Stojan, der später, als er älter wurde, kaum mehr von ihrer Seite wich. Die beiden schienen unzertrennlich zu sein. Überall, auf dem Acker, auf dem Feld, immer waren sie zusammen. Stojan gab ihr auch nie zu spüren, dass sie bei ihnen nur Magd war. Er machte ihr Geschenke, überreichte ihr, vor seinem Vater verheimlicht, Korn, Mehl und andere Speisen, die sie ihren armen Eltern brachte. Stojan war mild, friedlich, still; und arbeitsam war er, wie kaum jemand. Ach, diese Tage!
Sie gehen auf den Acker, um frische Tabaktriebe auszubrechen. Die Setzlinge reichen ihnen bis zum Gürtel, unter den nackten Füßen bricht und zerbröckelt die trockene Erde, sie sind von einem unendlichen, üppigen Grün umgeben. Die frische, saubere Luft prickelt, wärmt und treibt ihnen das Blut in die prallen Wangen. Sie arbeiten, brechen die Triebspitzen aus. Vom Fluss her weht ein leiser Wind und trägt ihnen von den abgeernteten Stoppelfeldern den Gesang der Turteltauben entgegen... Sie arbeiten, laufen um die Wette, necken sich, zanken, rücken voneinander ab, als wären sie sich böse.
Beide schweigen. Und dennoch blicken sie sich aus den Augenwinkeln heimlich an; ein trotziges Lächeln umspielt ihre Lippen. Cveta trägt ein enges Jäckchen und ein Kopftuch, schaut ihn mit einem neckischen, dreisten Lächeln beinah verstohlen an, sieht, wie er sich kratzt, sich windet, wie er sie betrachtet und ihr etwas sagen möchte. Doch sie dreht ihm den Rücken zu, stellt sich ahnungslos.
„Cveta!“, sagt er schließlich. „Lass uns singen.“
„Ich will nicht.“
„Warum nicht? Schau, wie ich dich bitte!“
„Ausgerechnet du! Ich will nicht.“
„Aber wenn ich dich doch bitte?“, sagt er mutiger und geht auf sie zu.
„Warum ärgerst du mich?“, fragt sie, lacht von Herzen, kommt ihm näher und spielt noch immer die Beleidigte. „Los. Mach schon!“
Sie stimmen ein Lied an, das damals überall bekannt war. Ihre reinen, hellen Stimmen beben vor Freude. Ihre Hände arbeiten und fliegen, ihre Verse breiten sich über die ganze Umgebung aus:
Es weht der Wind, es weht der Wind, rote Nelken duften;
Der Liebste schreibt ein Büchlein zart seiner Allerliebsten!
„Cvet-a-a!“, jauchzt Stojan auf und macht einen Schritt zurück, um sie besser sehen zu können.
„Was hast du?“, fragt sie schelmisch.
„Du bist..., du gehörst... mir!“
„Ech!“, entfliegt ihrer Brust ein unverhoffter, tiefer Seufzer. Und sogleich beugt sie sich nieder, um ihre Freude, ihre roten Wangen, zu verstecken. „Bitte nicht, Stojan! Komm, lass uns arbeiten.“
„Nein, nein...“, stammelt er.
Er packt sie rücklings, unter den Achselhöhlen, drückt sie an sich... Sie wehrt sich, windet und sperrt sich, aber so schwach, dass sie sich ihm nur noch mehr hingibt, sich an ihn schmiegt.
„Nein, genug, genug jetzt, süßer Stojan...“, flüstert sie und verdeckt ihr Gesicht. „Genug. Man wird uns noch sehen... och!...“
„Nur ein bisschen noch, ein bisschen. Komm!“, stammelt Stojan und drückt sie heftiger an sich, umarmt sie, küsst sie, wohin es trifft.
„Jetzt aber genug... Och, du bist wirklich...?!“ Und erschöpft, betäubt, glückselig, lässt sie sich gehen, hält bald die eine, bald die andere Wange zum Kuss hin.
Es war Herbst, als Cveta an einem Abend gesagt wurde, sie solle sich festlich anziehen und sich schmücken. Dann trat Stojans Vater aus dem Haus, nahm sie bei der Hand und führte sie in die Gaststube.
„Küss ihnen die Hand!“, sagte er und zeigte auf die Menschen, die gekommen waren. Sie taumelte, schaute ihn erschrocken und flehend an – es war der scharfe und rohe Ausdruck seines Gesichts, der sie alle Kräfte zusammennehmen und nicht ohnmächtig werden ließ. Kaum imstande zu gehen, küsste sie den fremden Menschen die Hand. Man beschenkte sie. Zum Erstaunen aller küsste sie auch Stojans Vater auf die Stirn und zog einen großen Dukaten, einen Dubla, hervor.
„Auf dein Glück, Tochter, dass es lange währe. In meinem Haus hast du mit einem hölzernen Löffel gegessen, in deinem soll es ein silberner sein, so Gott will.“
Man führte sie hinaus. Sie brach zusammen. Die ganze Nacht war sie nicht bei sich.
Nach diesem Tag bekam Cveta Stojan bis zur Hochzeit nicht mehr zu Gesicht. Sie wurde verheiratet. Sie heiratete Jovan, der zwar nicht arm, jedoch Witwer und ein arger Geizhals war... Ihr Herz wollte zerspringen. Und dennoch setzten sich schließlich ihre starke Natur und die nimmer endende, schwere, tägliche Arbeit durch. Sie erstickte alles, was gewesen war.
Doch jetzt, seit einiger Zeit, tauchte Stojan wieder auf, suchte sie, lauerte auf jede Gelegenheit, sie zu treffen, sie zu sehen und mit ihr zu sprechen. Sie aber wollte ihn nicht sehen, sie wollte seine weiche, weibliche Stimme nicht hören.
Auch er war nicht glücklich geworden. Sie vermählten ihn mit einem Mädchen aus einem reichen, bekannten Haus. Doch es schien, als hätte man ihn nicht verheiratet. Er fand zuhause keine Ruhe. Seiner Frau schenkte er kaum Beachtung, er flüchtete nur immer – angeblich der Arbeit wegen – in die Dörfer, zu den ?if?ijas, wo die Familie ihre Felder hatte, verbrachte da Tage und Wochen. Was versuchten sie nicht alles, um ihn an seine Frau zu binden. Alles vergeblich. Sie besprengten ihn mit Stechapfelsud, verabreichten ihm Kräuter, führten ihn zu Klöstern, zu Wahrsagern, er aber wurde weder gesprächiger noch lebendiger. Er schwieg nur immer die ganze Zeit, arbeitete, ließ seine Mutter mit ihm machen, was sie wollte. Er trat keinem entgegen, fing mit keinem Streit an. Den Vater trieb er mit seinem Verhalten an den Rand des Wahnsinns. Einmal verlor der Alte die Fassung, prügelte ihn windelweich, jagte ihn aus dem Haus und verbot allen, seinen Namen auch nur zu erwähnen. Die Mutter grämte sich vor Kummer und Scham fast zu Tode. Sie bat, flehte Stojan an, er möge doch wenigstens ihr, wenn nicht seinem Vater oder einem andern, sagen, warum er von zuhause, von seiner Frau fliehe. Vergeblich... Und wer weiß, wie lange es gedauert hätte, wenn nicht die Verwandten der Braut, die bald über alles Bescheid wussten, verlangt hätten, dass man ihnen die getraute Tochter zurückführe. Denn sie hätten sie, meinten sie, nicht dem Alten und seinem Haus gegeben, sondern Stojan...
Der Vater rief Stojan zu sich, ohne zu wissen, was er mit ihm machen würde. „Setz dich!“, sagte er finster und zeigte neben sich auf das Sofa. Stojan blieb, wie immer, vor ihm stehen.
„Lass nur“, antwortete er, „ich kann auch stehen“.
„Setz dich neben mich, setz dich, wie es sich einem Mann und Hausherrn geziemt!“ Das Wort „Hausherr“ sprach er dabei so eindringlich und gedehnt, dass Stojan ehrerbietig schwieg, ohne sich zu setzen.
„Setz dich und sprich!“, herrschte der Alte ihn an und sprang von seinem Platz auf. „Oder bist du stumm geworden, Herrgott! Sprich, ich will hören, ich will sehen, dass du noch sprechen kannst, ich will deine Stimme hören... damit ich weiß, dass du noch lebst?!“
„Was kann ich dir denn sagen?“, murmelte Stojan und zuckte mit den Achseln. Er war auf alles gefasst.
„Was, was???...“, stieß der Alte hervor. Sein Haar sträubte sich, wutentbrannt beugte er sich vor und krallte sich ungewollt an seine Joppe. „Du fragst noch, du fragst noch? Ich bringe dich um, ich bringe dich um. So etwas ist kein Sohn!“ Er erhob die Faust. „Muss ich denn wirklich erleben, dass man ein getrautes Mädchen aus meinem Haus führt?... Ich, ich, das erleben?!... Sprich, sag!“ Er packte ihn wütend an der Brust und begann ihn zu schütteln und zu stoßen. „Sag!... Ich bringe dich um, ich bringe dich um! Dass ich dich nicht mehr sehen muss!...“
„Töte mich!“
Der Alte sprang zurück.
„Töten! Das tu ich, jetzt gleich!“ Und schon wirbelte er durch das Zimmer, als suchte er einen Gegenstand, mit dem er ihn erschlagen könnte. Stojan schwieg, senkte das Haupt, wartete... „Das tu ich, hej, jetzt gleich!“, wiederholte der Alte. Im selben Augenblick aber besann er sich und seufzte: „Nein, ech, mein Sohn! Nicht so, ich bitte dich!... Hier, ich... ich bitte dich!“ Zitternd kniete er sich vor ihn nieder und nahm die Mütze vom Kopf. Sein weißes Haar fiel ihm auf Hals und Achseln. „Hier, töte du mich... töte du mich!“, schluchzte er. Sein ganzer Körper, die Hände, die Schultern, der Kopf, alles bebte.
Stojan, zu allem bereit und auf alles gefasst, nur nicht, dass ihn der Vater so anflehte, schrak zurück: „Nein...!“
Er beugte sich nieder, wollte den kauernden Vater aufrichten, doch als er die großen, warmen Tränen bemerkte, die von den Augen des Alten auf seine Hände tropften, wich er zurück, erschauderte und rannte aus dem Zimmer.
Von diesem Tag an veränderte sich Stojan von Monat zu Monat. Er kam seiner Frau näher, begann mit ihr wie andere Verheiratete zu leben, blieb zuhause, überwachte die Arbeiten, besuchte mit ihr und seiner Mutter die Verwandten und ging mit ihnen auf die Kirchfeste... Alle freuten sich.
Doch jetzt, als es wieder Sommer wurde – wer weiß, was über ihn gekommen war? –, begann er von neuem über die Felder zu streifen, sich länger in seinem Dorf aufzuhalten. Und was für sie, Cveta, wichtiger und schrecklicher als alles andere war, er suchte auch sie wieder auf. Zwar kam er meist mit ihrem Mann, doch sie wusste, sie spürte, warum er kam, denn immer versuchte er, auch sie zu sehen. Wenn sie auf den Acker ging, kam er von weit her, machte große Umwege, um den Anschein zu erwecken, dass er sie nur zufällig traf. Und auch wenn er sich nur mit den üblichen Grußworten an sie wandte und ihnen nichts beifügte, fürchtete sie sich vor diesen Treffen. Sie konnte ihm nicht begegnen, ohne von Angst und Unruhe ergriffen zu werden. Bereits wenn sie ihn erblickte, ihn sah, wie er näher kam, sein Auge nicht von ihr abwandte, wie er zitterte, wie ein schmerzliches, mattes Lächeln auf seinen Lippen lag, schnürte sich ihr Herz zusammen, erbebte ihr Körper und quollen Tränen in ihre Augen...
Ihr eigenes Leid hatte sie längst überwunden, doch jetzt, wenn sie ihn sah, litt sie mit ihm mit, beweinte ihn, auch wenn sie sich zurückhielt und sich zwang, grob und streng zu ihm zu sein. Wer weiß, was geschehen würde, wenn sie sich anders benähme? Aber ist nicht alles umsonst? Zwar schwört er bei jedem Kommen, es sei das letzte Mal, doch taucht er wieder und wieder auf!... Ach! Und von den einstigen Tagen ist nur seine schöne, volle, weiche Stimme geblieben.
Seit damals sang Stojan nur noch höchst selten. Doch wenn er ein Lied anstimmte, sang er so ausdrucksvoll, so traurig, dass alle vor Sevdah verschmachteten... Wie oft sah sie ihn dann von ihrem Fenster aus, nur sie, wie er im Morgengrauen von den fernen Weideplätzen nach Hause ritt und leise, klar und traurig sang... Er singt, und doch erklingt keine Stimme. Es ist nur der Mond, der strahlt und flimmert. Ihr, Cveta, aber kommt es wie eine Versuchung vor – bewahre Gott! – als ob sie, wie in den Geschichten erzählt, fliegen könnte, sich zu ihm aufs Pferd setzte, sich an ihn drückte, und beide, umschlungen, im Mondlicht, über Felder und Berge flöhen, weit, weit weg!...
„Im Mondlicht, umschlungen, weit, weit weg!...“ begann Cveta abwesend und gut vernehmbar zu flüstern, während sie sich nach vorne beugte und ihre Brüste zusammenpresste. „Im Mondlicht... Jaoh!“, schrie sie erschrocken und wich ängstlich zurück. Sie sah sich selbst und die ganze Umgebung im Mond leuchten, der schon längst aufgegangen war.
„Mein Gott, mein Herrgott!... Gottvater, heilige Gottesmutter... Herrgott, Herrgott... oh Gott, was ist das!“, flüsterte sie, vor Angst zitternd und den Blick vor dem Licht des Mondes senkend. „Bring mich zur Vernunft, lieber Gott... Och, wie sündig und verdorben ich bin!“
Sie stellte sich ihre Sünde, ihre unreinen Gedanken, ihre Qualen im Jenseits in den dunkelsten, schrecklichsten Farben vor... Und um sich zu beruhigen, zu rechtfertigen, erhob sie sich, betrachtete die Umgebung und den jagenden Mond am hellen Himmel, bekreuzigte sich, verneigte sich und betete flüsternd um Schutz gegen die bösen Geister, die Versuchung, das unsaubere Blut... Der helle Mond beleuchtete ihre schlanke Gestalt, ihre breiten Schultern, das wohlgeformte glühende Gesicht mit den heißen Lippen, die schwarzen, dunklen, leicht eingefallenen, feurigen Augen... Sie bekreuzigte und verneigte sich. Der Mond glänzte, strahlte, und es schien, als käme mit dem Licht auch das Leben zurück. Von allen Seiten ertönten Stimmen, Rufe, Gemurmel, erklangen die Lieder der nächtlichen Arbeiter. Die weithin beschienenen Felder, die sanften Vertiefungen, der Fluss und die Bäche mit den hohen Pappeln und den dichten Weiden, alles war bewegt, als atme alles auf und spüre den Balsam der stillen, nächtlichen Düfte. Cveta bekreuzigte sich, zitterte, horchte auf das Rauschen des Flusses in der Ferne. Sie hörte das Rascheln der Blätter, die getüderten Pferde auf der Weide, die Schläge der Hauen... Sie horchte, bebte, konnte nicht arbeiten. Ihre sündigen Gedanken erfassten sie ganz und erfüllten sie mit unbeschreiblicher Trauer und Angst. Sie stützte sich wie gebannt auf die Haue, ohne in eine bestimmte Richtung zu blicken. Sie sah nicht einmal das Wasser, das sie erreichte, sich rieselnd und glucksend in die trockenen, durstigen Löcher ergoss und in den benachbarten Acker strömte... Plötzlich, inmitten dieses nächtlichen, blendenden Glanzes, erhob sich eine helle, traurige, bebende Stimme, die sich weithin ausbreitete.
Cveta erkannte sie augenblicklich und erstarrte.
„U-u-uh!“, brach es aus ihr heraus und sie warf sich mit dem Gesicht auf die Erde.
„Hej, Stojan! Hört, wie Stojan singt!“, vernahm man von überall her begeisterte Rufe, als würden sie ihm antworten. Es war tatsächlich Stojan, der in der Ferne, auf dem Weg nach Hause, jenes Lied sang:
Es weht der Wind, es weht der Wind, rote Nelken duften;
Der Liebste schreibt ein Büchlein zart seiner Allerliebsten!
„Och, genug, genug!...“ flüsterte Cveta unwillkürlich, als richteten sich ihre Worte an ihn und an sich selbst zugleich, sie, die in gebeugter, geduckter Haltung ihre Brust umklammerte und an ihren Tränen und aufwallenden Gefühlen fast erstickte. Außer sich, wie besessen, küsste und biss sie sich rasend in die Brüste und prallen Arme, presste die Faust an den Mund, als wollte sie aufhalten, was aus ihr herausströmte und sie umfing... Das Lied erklang noch immer. Stojan sang innig und traurig wie nie zuvor. Seine helle Stimme bebte und hallte, erhob sich in die glänzenden Höhen der stillen, leuchtenden Nacht...
Damit du es weißt, Junge, damit du es weißt,
Welches Klagen, o Jugend, welches Leid?!
„Klagen!...“ seufzte Cveta laut. Und gebrochen, überwältigt, hob sie den Kopf, öffnete den Mund in die Richtung des Gesangs, als möchte sie die letzten Klänge, die nun verstummten, in sich aufsaugen.
„Das Wasser fließt, und du?“, schreckte die Stimme ihres Mannes sie auf. Jovan war zurückgerannt, voller Freude, dass er das Wasser zuleiten konnte. Doch als er sah, dass seine Frau nicht zur Stelle und die Furchen ungeöffnet waren, das tränkende Nass in den Acker des Nachbarn floss, wurde er rasend, hob die Haue und stürmte, bebend vor Wut und Gram, auf sie zu. „Was ist das, a-a-a?“, zischte er sie an.
„Nicht, Jovan!“, stammelte sie, als sie begriff, dass sie das Wasser vergessen hatte. Sie fühlte sich schuldig, erwartete von ihm Hiebe, senkte das Haupt und bemühte sich, vor ihm aufzustehen. Ohne zu wissen, wie sie sich herausreden würde, flehte sie ihn an: „Bitte nicht, ich bin krank!“
Ihr glänzendes und glühendes Gesicht, die aufgebissenen Lippen, die feurigen Augen, die zerzausten Haare, das aufgeknöpfte Jäckchen, ihre ganze Erscheinung ließ Jovan denken, sie könnte schwanger sein und gerade jetzt ihr Kind unter dem Gürtel spüren. Er ließ die Haue sinken, zitterte vor Freude.
„Was hast du?“
„Och, du weißt nicht!“, begann sie zu klagen. „Du weißt nicht!“
Jovan spürte in ihren Worten etwas Vorwurfvolles: Immer wieder treibt er sie zur nächtlichen Arbeit an, obwohl er doch sehen kann, dass sie schwanger ist.
„Weine nicht! Warum sagst du mir denn nicht, dass ich dich zuhause lassen soll. Warte!“, sagte er sanft, bückte sich, nahm sie in die Arme, trug sie an den Flurrand, legte sie nieder, zog seinen Kittel aus, bedeckte und wärmte sie, um schließlich loszurennen und das Wasser umzuleiten...
„Jetzt aber genug, weine nicht. Hab keine Angst. Es geht vorüber“, ermunterte er sie. Und während das Wasser in die Furchen floss, horchte er, wie sie seufzte, weinte und fieberte...
Georgstag
Wann denn bricht einem das Herz und hüpft die Seele vor Entzückung und süßer Trauer, wenn nicht bei Erinnerungen an vergangene Tage, heimatliche Orte und Freunde aus der Kindheit... Der verstorbenen Freunde erinnert man sich mit Andacht und Ehrfurcht und die noch lebenden blickt man verwundert an, wie sie sich verändert haben...
Ich sehe eine belebte Straße, die von hohen, mit großen Toren versehenen Mauern gesäumt und einer Reihe ausladender Bäume begrünt und geschmückt ist. Ich höre die Freunde, wie sie mich rufen, um am Fluss grüne Weidenruten zu schneiden. Ich sehe die Mutter, wie sie im Garten gebückt Kräuter sammelt, um sie mit einem Osterei und einem silbernen Parastück in ein Wasserbecken unter dem Rosenstrauch zu legen.
Morgen ist Georgstag!
Abend. Mondschein. Ich sitze auf der Türschwelle und schaue, wie der Mond durch die Wolken treibt. Er verströmt ein süßes, sehnsüchtiges Licht, das die ganze Welt traumhaft sanft verwandelt. Die Bäume, die Schatten, das Lispeln der Blätter, das Zirpen der Hausgrillen, alles gleitet, summt, hüllt die bebende und zitternde Seele ein. Man möchte fliegen, weiß nicht wohin. Soll ich die Sterne zählen? Singen? ...
Von der Straße ertönen Stimmen, Schritte. Ein Lied erschallt, breitet sich aus und taucht langsam, zitternd in die süße, sommerliche Abendstille ein!...
Mutter weckt mich früh. Noch schläfrig, von der morgendlichen Frische ermuntert, gehe ich in den Garten. Inmitten der Blumen steht unter einem Rosenstrauch das Wasserbecken, in dem ein rotes Ei schwimmt, umrahmt von Heilkräutern, Storchenschnabel und Hartriegel. Ich ziehe mich aus und steige ins Bad. Gewehrschüsse und fröhliche Stimmen durchbrechen die Morgenstille. Die ganze Umgebung, besonders die Niederungen, hallen vor Schüssen und Zurufen wider. Alle baden im Fluss: wer am Georgstag vor Sonnenaufgang ein Bad nimmt, wird das ganze Jahr gesund wie ein Hartriegel sein, dessen Blätter, ins Waser geworfen, überall auf der Flussoberfläche treiben...
Nach dem Bad gehe ich durch den Garten, pflücke Blumen, die meine Mutter mit einer Kerze auf Vaters Grab bringen wird. Unter einer Rose entdecke ich ein großes irdenes Gefäß – ein „?up?e“, das von Laub bedeckt ist.
„Was ist das, Mama?“, frage ich und kaure nieder, um das Tuch vom Topf zu nehmen.
„Nein, nein! Kind, lass es da, das ist die Mantafa.“
Der Mittag rückt näher, geht vorüber, ich sitze am Fenster und lese. Aus dem Garten weht ein leichter Wind. Ich bin in eine Erzählung vertieft, die mir fast den Atem raubt. Plötzlich vernehme ich ein Kichern. Ich fahre auf und erblicke im Garten eine Schar Mädchen aus der Nachbarschaft.
Sie haben sich um das ?up?e versammelt, alle sind festlich gekleidet: schneeweiße Kopftücher – Šamijas –, enge, an die rundlichen Brüste geschmiegte Jäckchen, breite Šalvaren, die schöne Falten werfen, durchscheinende Hemden mit weiten Ärmeln, aus denen nackte, weiße, volle Arme ragen... Sie sitzen im Gras, kauern neben den Blumen oder zerplatzen Blätter auf der Hand, um zu erfahren, ob ihre Angebeteten sie lieben und ihnen die Treue halten.
Ich lehne mich aus dem Fenster.
„Was habt ihr vor?“, frage ich.
„Wir ziehen jetzt die Mantafas. Weißt du, dass auch du eine hast? Sie hat sie hineingelegt.“
„Ech?!“, – ich lehne mich noch weiter aus dem Fenster.
„Ja, ja!“, rufen sie, „wir wissen sogar, was für eine. Sie bindet ihre Sträuße mit einer roten Schnur und steckt in jeden eine Tulpe.“
„Und eure?“
„Eh, das brauchst du nicht zu wissen. Weck du lieber Tantchen.“
„Gut, gut. Und darf ich mich dann zu euch setzen?“
„Natürlich, wir sind doch hier bei dir!“
Sie verlassen den Garten und gehen in den Hof. Zu ihnen gesellen sich weitere Frauen, Mädchen und Kinder aus der Nachbarschaft, alle drängen sich um den Brunnen, suchen sich unter den großen Maulbeer- und Aprikosenbäumen die besten und kühlsten Plätze aus. Jede, die hinzukommt, zieht einen Wassereimer hoch, wäscht sich, begießt sich die Füße, trocknet sich mit der Boš?a das Gesicht, setzt sich in den Schatten und beginnt mit den andern zu plaudern. Das Rumoren wird immer lauter. Lachen, Jubeln, gedämpfte Vorwürfe, man habe zu sehr gekniffen, süßes, leidenschaftliches Kichern und leises Flüstern – alles erhebt sich zu einem Brausen und Klingen und verliert sich im hellen, heißen, glühend-flimmernden Tag.
Als sich alle versammelt haben, kommen ein paar Mädchen zu mir ins Zimmer, damit wir gemeinsam meine Mutter wecken. Die eine bringt ihr Wasser, die zweite rückt ihr das Kopftuch zurecht und die dritte übergießt ihre Hände und trocknet sie mit einem Tuch. Darauf gehen alle nach draußen und setzen Mutter in ihre Mitte. Sie holen das ?up?e, bedecken das Mädchen, das die Sträuße herausziehen soll, mit einem Schleier und drücken ihm einen Spiegel in die Hand.
Erst jetzt, nachdem schon alles begonnen hat, kommt auch sie. Hochgewachsen, üppig, mit schwarzem Haar, das in langen Zöpfen über den Rücken fällt, mit großen schwarzen Augen, langen, dunklen Wimpern und kleinen, vollen, prallen, eher dunkelroten als rosafarbenen Lippen, so rot, als hätten sie sich an einem großen Feuer entzündet. Ihr Jäckchen ist aus blauer Seide, die Šalvaren halbseiden; sie geht barfuß in hölzernen Nanulen, lächelt lieblich, mild, setzt sich neben Mutter.
Die Mantafa beginnt. Mutter spricht sie erst auf Türkisch aus, um sie dann ins Serbische zu übersetzen. Im Türkischen ist die Mantafa kurz, in Versform gehalten, die Vranjer Frauen schmücken sie in der Übersetzung jedoch aus, ergänzen und erweitern sie. Zuerst wird die türkische Mantafa aufgesagt, dann ein Strauß gezogen und schließlich die Übersetzung der Besitzerin des Straußes auf Serbisch zugeraunt.
Mutter beginnt: „Ich weiß nicht, wie mir ist! Seit ich dich gesehen habe, ist mir die Welt so eng. Umsonst sind Tanz, Lied und Fest, vergeblich alles! Komm, mein Herz, komm an mein Pendžer, dass ich dich sehen, den Duft deiner Haut riechen, den Glanz deiner Augen sehen kann. Ach, mein Mädchen, wenn du nur wüsstest, wie sehr ich dich liebe, wie ich mich nach dir sehne! Du bist mir lieber als die leibliche Mutter, lieber als die leibliche Schwester, deine schlanken Hüften, dein ebenmäßiger Körper sind mir lieber als alles Hab und Gut von Istanbul! Komm abends, klopf ans Pförtchen oder wirf mir wenigstens einen Stein über die Mauer, damit ich ihn an meine Brust drücken und küssen kann... Och, komm, komm, zeig dich mir! …“
Das verschleierte Mädchen hält die Hand ins ?up?e, rührt um und zieht einen Strauß heraus. Alle beugen sich vor, um zu sehen, wem er gehört. Mit glühenden Augen und gesenktem Kopf streckt ein Mädchen seine Hand aus, ergreift das Gebinde.
„Ah, warte!...“, ruft eine ältere Frau und spricht neckend auf das Mädchen ein: „Kommst du nicht jeden Abend, wenn du vom Feld zurückkehrst, hier vorbei, sag!“
[...]
-
Viktor Kalinke, 12.04.2023Profund, packend - ein Leben vor, während und nach dem Großen Krieg.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden