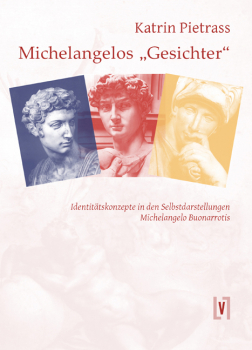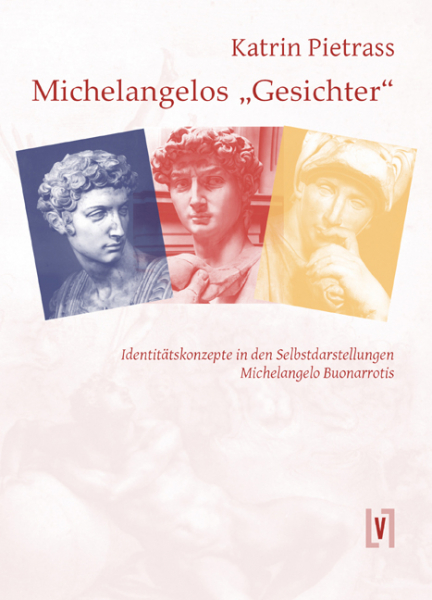



Katrin Pietrass analysiert einen der berühmtesten Selbstdarsteller der Renaissancekunst. Zweifelsohne war es der Bildhauer, Maler und Architekt Michelangelo Buonarroti, der über die Spanne seines Lebens hinweg wie kaum ein anderer Künstler eine so vielschichtige Werkgruppe an sich wandelnden Selbstdarstellungen geschaffen hat. Die Autorin fragt nach den "Gesichtern" und, weiter gefaßt, nach den Identitätskonzepten in den Selbstdarstellungen Michelangelos. Im Buch wird aufgezeigt, daß Michelangelo trotz der Außerordentlichkeit seiner Werke kein isolierter Künstler war, der abseits sozialer Normen lebte. Denn die Beschreibung gesellschaftlicher Kontexte, tradierter Rollenentwürfe und kunsttheoretischer Topoi, die der Künstler in seinen Werken thematisierte, zeigt vielmehr ein hohes Maß an Selbst- und Weltreflexion und in der Konsequenz die verschiedenen "Gesichter" Michelangelos.
Katrin Pietrass: geb. 1978 in Göppingen, Studium der Kunstgeschichte an der Universität Leipzig, Promotionsstipendien des Freistaates Sachsen und der Studienstiftung des deutschen Volkes, 2010 Promotion an der Universität Leipzig, lebt und arbeitet in München.
Leseprobe:
Vorbemerkung
In einem Brief, der in den Sommer des Jahres 1544 datiert, kommt Niccolò Martelli auf Michelangelo Buonarroti (1475–1564) und dessen Werke in der Florentiner Kirche San Lorenzo zu sprechen. Im Zuge seiner Ausführungen kolportiert er eine Aussage des Künstlers zu den Skulpturen, die dort über den Grabmälern von Lorenzo und Giuliano de’ Medici in der Neuen Sakristei[1] thronen (Abb. 1 und 2):
„... als Michelangelo, einzig und einmalig auf der Welt, in der Bibliothek von S. Lorenzo in der Stadt Florenz die hohen Herren des gesegneten Hauses Medici zu skulpieren hatte, da nahm er weder vom Herzog Lorenzo noch vom Herrn Giuliano das Vorbild genau so wie die Natur sie porträtiert [.] und zusammengesetzt [.] hatte, sondern er gab ihnen eine Größe, eine Proportion, eine Schicklichkeit, eine Grazie, einen Glanz, was ihnen, wie er meinte, mehr Lob bringen würde, wobei er sagte, dass heute in tausend Jahren niemand Kenntnis davon geben könne, daß sie anders gewesen seien, sodaß die Leute, indem sie sie betrachteten, davon in Erstaunen versetzt würden.“[2]
Die Rekonstruktion der Porträtauffassung Michelangelos aus dieser überlieferten Aussage heraus vermag zu verdeutlichen, wie weit sich der Künstler vom Postulat der Ähnlichkeit[3] entfernte und das ritrarre und sogar das imitare vernachlässigte zu Gunsten einer absoluten, nicht mehr am naturgegebenen Aussehen der Herzöge orientierten Idealisierung, die er mit Hilfe geschönter Gesichtszüge und einem Komposit aus Militärattributen, die zum Teil der römischen Kaiserikonographie entlehnt sind, visuell sichtbar in die Skulptur überführte.[4] Wie Rudolf Preimesberger treffend bemerkt, „[...] hat sich hier das Erfinden gegen das Abbilden, die Fiktion gegen die Wirklichkeitsbindung durchgesetzt.“[5] Die beigefügten Attribute dienten sinngemäß der Verkleidung oder Maskierung, die den Capitani einen besonderen, ihrem natürlichen Wesen entgegengesetzten Status und damit eine andersartige Rolle verliehen. Wenn Niccolò Martelli darauf verweist, dass Michelangelo gerade nicht das von der Natur zusammengesetzte Bild der Herzöge wiedergegeben, sondern ein selbst komponiertes und gleichfalls aus unterschiedlichen Elementen zusammengefügtes Bildnis erschaffen hatte, dann drängt sich unmittelbar Giorgio Vasaris Äußerung auf, Michelangelo habe sich gelegentlich der Technik der Zusammenfügung mehrerer Vorbilder bedient, um das Bildnis eines idealschönen Menschen zu kreieren – womit sich der Künstler an dem antiken Maler Zeuxis orientierte, von dem Plinius in der Naturalis historiae überlieferte, dass er für die Anfertigung eines Bildnisses die fünf schönsten Mädchen der Stadt Agrigent auswählte, um aus ihren jeweils schönsten Körperpartien ein idealschönes Bildnis zu erschaffen.[6] Indem sich Michelangelo also vom Postulat der Nachahmung entfernte, erzeugte er nicht nur durch ein verändertes Abbild ein verändertes Bild der Capitani, sondern stattete die Medici-Herzöge außerdem mit einer neuen Identität aus, die ihnen zu Lebzeiten nicht zu eigen war und die ihnen, wie er selbst bemerkte, posthum mehr Lob einbringe. Damit verweist der Künstler auf die Wirkmacht eines Porträts, die imstande ist, die Vorstellung von einer Person in entscheidender Weise zu formen.
Die offenkundige Besonderheit der Skulpturen und der Schriftquelle, die sowohl für ihre Form als auch für ihren Inhalt gilt, soll zum Ausgangspunkt für die Entwicklung der Fragestellung und der Methodik der vorliegenden Analyse genommen werden. Denn zur künstlerischen Selbstdarstellung Michelangelos sind keine vergleichbaren Aussagen überliefert, wie sie der Brief Niccolò Martellis für die Porträtauffassung des Künstlers bereithält. Und doch liefert der Bericht Martellis wichtige Hinweise, die ebenso – wie im Folgenden gezeigt wird – für die Entwicklung einer Theorie der Selbstdarstellung von zentraler Bedeutung sind.
Es waren weniger Porträts als vielmehr Selbstdarstellungen, die Michelangelo im Laufe seines Lebens anfertigte.[7] Vor dem Eingangs skizzierten Hintergrund stellt sich die zentrale Frage, ob bei der Anfertigung von Selbstdarstellungen ähnliche Mechanismen der Konstruktion von Rolle und Identität im Bildnis greifen, wie sie bei den Capitani im Medium Porträt fassbar sind und welche die Porträtforschung als eine der wichtigsten Aufgaben der Porträtkunst im Allgemeinen definierte.[8] Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte die Sozialgeschichtsschreibung der italienischen Renaissance für die Entdeckung des Individuums mit den Erkenntnissen Jacob Burckhardts ein Modell bereitgehalten, das in der Renaissance das Zeitalter des erwachenden Individualismus erkannte[9] – ein Konzept, welches in der jüngeren Forschung einer kritischen Befragung unterzogen und in unterschiedliche Richtungen ausdifferenziert wurde.[10] Denn unter einem verfeinerten Blickwinkel ist das wachsende Interesse am Individuum erstens nicht erst – gemeinsam mit dem Aufkommen des Porträts – im Florenz des 15. Jahrhunderts anzusetzen, wie es Burckhardt in seiner Kultur der Renaissance in Italien schrieb, konnte doch verschiedentlich aufgezeigt werden, dass der Individualismus nicht erst ein Signum der Frühen Neuzeit, sondern bereits im Mittelalter in unterschiedlichen Formen ausgeprägt war.[11] Zweitens setzten vor allem auch mit dem aus dem Poststrukturalismus kommenden Lehrsatz vom „Tod des Subjekts“ seit den 1960er Jahren die Hinterfragung und gar Abschreibung des Individualitätsbegriffes und die Diskussion um die Konstrukthaftigkeit des Individuums ein.[12] In zunehmendem Maße wurden soziale, politische, wirtschaftliche, religiöse und historische Parameter als Determinanten erkannt, die auf das Subjekt einwirken – am weitreichendsten beurteilen die Vertreter des New Historicism, allen voran Stephen Greenblatt, diese Faktoren, und sprechen dem Individuum den eigenmächtigen Handlungs- und Gestaltungsspielraum hinsichtlich seiner eigenen Identitätsausformung vollkommen ab, wodurch der Mensch als allein von der Kultur geprägt und damit komplett fremdbestimmt beschrieben wird.[13] Aus diesen hier nur grob skizzierten Vorüberlegungen, die im weiteren Verlauf aufgegriffen und ausdifferenziert werden, leiten sich die zentralen Forschungsfragen ab: Michelangelos Selbstdarstellungen sollen danach befragt werden, inwieweit sie als Medien der Herstellung und Darstellung von Identität funktionieren und demzufolge eine Identität stiftende Funktion erfüllen. Diese These schließt die Frage danach ein, inwieweit die unterschiedlichen Formen dieser Selbstpräsentationen als Ausprägungen eines differenzierten, in Grundzügen von zeitgenössischen Vorgaben geprägten Rollenverständnisses angesehen werden können und welche Rollenmodelle den in den Kunstwerken verhandelten Selbst- und Identitätsentwürfen zu Grunde liegen. Hier schließt sich, anders formuliert, demnach unmittelbar der Versuch an, Michelangelos „Gesichter“, mit denen er im Privaten und in der Öffentlichkeit agiert, zu erkennen und zu beschreiben. Schließlich stellt sich die Frage, inwieweit die Selbstdarstellungen zielgerichtet auf ein Publikum ausgerichtet sind. Über eine notwendigerweise interdisziplinäre Herangehensweise, die Methoden aus der Sozialgeschichte, der Kulturanthropologie oder den Gender Studies mit einbezieht, ergibt sich die Möglichkeit, ein kunsthistorisches Forschungsgebiet mit anderen Fragestellungen zu konfrontieren und daraus fruchtbare Antworten und weiterführende Überlegungen zu entwickeln.
Eine besondere Herausforderung liegt darin, die komplexe Interdependenzbeziehung zwischen der gesellschaftlichen Ordnung im Italien des Quattro- und Cinquecento einerseits und den darin agierenden Individuen andererseits zu erarbeiten. Darum ist es nicht möglich, Fragen nach den in den Selbstdarstellungen verhandelten Identitätsvorstellungen Michelangelos ohne Fokussierung des Kontextes, der sozialen Räume und der Zeitgenossen zu stellen. Die Positionen, die in den Kunstwerken zum Ausdruck kommen, werden mit Hilfe der sozialgeschichtlichen Methoden in die sozialen Räume zurückprojiziert, denen sie entstammen, es wird ihnen gewissermaßen, wie es Kitty Zijlmans und Marlite Halbertsma fordern, ihr ursprünglicher Kontext zurückgegeben, dem auch ihr Schöpfer angehörte.[14] Mit diesem Anspruch reiht sich die Arbeit ein in neuere und neueste kunsthistorische Diskurse zur Erforschung der künstlerischen Selbstdarstellung, die nach Voraussetzungen, Kontexten und Adressaten der Werke fragen, um daraus Rückschlüsse über die Entstehungszusammenhänge abzuleiten.[15]
Ehe ab dem zweiten Kapitel die Selbstdarstellungen Michelangelos im Hinblick auf die formulierten Forschungsfragen untersucht werden, sind in diesem Kapitel zunächst ein Forschungsüberblick und diesem folgend die Darstellung der methodischen Verortung sowie die Klärung wichtiger Begriffe vorangestellt, ehe diese zunächst auf Kunstwerke Michelangelos, die nicht zum Œuvre der Selbstdarstellungen gehören, übertragen und angewandt werden. Neben der sich anschließenden Diskussion des Forschungsstandes zur Selbstdarstellung Michelangelos im Allgemeinen finden sich innerhalb der Kapitel ausführliche Vergleiche der Forschungspositionen, welche die Werkanalysen ergänzen. In den Bereich der vergleichenden Quellenanalyse reicht außerdem die intensive Auseinandersetzung mit den Lebensbeschreibungen der Biographen Ascanio Condivi und Giorgio Vasari, welche die Argumentation durchgängig begleitet.
1.1 Forschungsstand
Als Ernst Steinmann 1913 seine bis heute grundlegende Studie über die Porträtdarstellungen des Michelangelo vorlegte, bemerkte er darin noch bedauernd, dass Michelangelo kein gemaltes Selbstporträt von sich angefertigt habe.[16] Tatsächlich befindet sich unter den Selbstdarstellungen des Künstlers kein autonomes Selbstbildnis; die gelegentlich in der Forschung vertretene Zuschreibung eines in Feder ausgeführten Bildnisses Michelangelos an den Künstler selbst, auf dem er, wie auf dem von Giuliano Bugiardini ausgeführten Porträt, einen Turban auf dem Kopf trägt, bleibt aufgrund der heterogenen Forschungslage und des schlechten Erhaltungszustands des Blattes zweifelhaft.[17]
Bis zum heutigen Zeitpunkt ist die Anzahl derjenigen Kunstwerke Michelangelos, die als Selbstdarstellungen, als Selbstthematisierungen oder als Werke mit biographischem Gehalt in der Forschung allgemein akzeptiert sind, auf insgesamt neun Werke beziehungsweise Werkgruppen angewachsen. Zu diesem Kreis gehören zum einen die drei physiognomisch mit dem Antlitz des Künstlers in Übereinstimmung zu bringenden Selbstdarstellungen auf der Bartholomäushaut im Jüngsten Gericht in der Sixtinischen Kapelle, in den Fresken in der Cappella Paolina und im Nikodemus der Florentiner Pietà sowie in diesem Umkreis eine zwar von Leone Leoni gefertigte, doch von Michelangelo wohl inhaltlich mitkonzipierte Bildnismedaille. In Anbetracht der physiognomischen Erkennbarkeit in den Selbstdarstellungen nimmt Michelangelo in einem rein quantitativen Vergleich mit zeitgleich arbeitenden Künstlerkollegen – zu nennen wären hier etwa Albrecht Dürer für den Raum nördlich der Alpen oder Baccio Bandinelli als italienischer Zeitgenosse – demnach keine Spitzenposition ein.[18] Zum anderen erschuf Michelangelo neben den physiognomisch identifizierbaren Selbstdarstellungen auch Selbstthematisierungen in Werken wie dem Marmordavid und den Geschenkzeichnungen für Tommaso de’ Cavalieri, in denen das Antlitz des Künstlers nicht erkennbar ist.[19] Darüber hinaus ergänzen eines der ersten erhaltenen bildhauerischen Werke des Künstlers, die Kentaurenschlacht, und die wenig später entstandene Römische Pietà die Untersuchung, da diese Kunstwerke wichtige Hinweise im Hinblick auf die Entwicklung des künstlerischen Selbstverständnisses bei Michelangelo bereithalten. Ferner handelt es sich bei der Vittoria um ein mit biographischem Gehalt aufgeladenes Kunstwerk. Um das Bild zu vervollständigen, wird außerdem gezielt die Rolle der Biographien sowie die Einflussnahme Michelangelos auf den Inhalt der Viten in die Analyse einbezogen.
Michelangelos Selbstdarstellungen entstehen vom ausgehenden Quattrocento bis zur Mitte des Cinquecento und damit in einer Zeit des Umbruchs, in der sich das Kunstschaffen zunehmend von der reinen Auftragskunst emanzipierte und in der sich die Bewertungsnormen von Kunst dahingehend veränderten, sie nicht länger dem Handwerk, sondern vielmehr dem Kreis der artes liberales zuzurechnen.[20] In diesem Spannungsfeld wird zu zeigen sein, dass gerade den Selbstdarstellungen Michelangelos, die enge Zusammenhänge zwischen Selbst und Werk offenbaren, in ihrer chronologischen Abfolge komplexe prozessuale Entwicklungsstrukturen zu eigen sind, die dem Künstler eine Sonderstellung innerhalb der Kunstgeschichte zuweisen.
Die Selbstdarstellungen Michelangelo Buonarrotis sind in den vergangenen Jahren regelmäßiger Untersuchungsgegenstand gewesen. Dennoch nimmt dieser Anteil gemessen am Gesamtvolumen der Forschungsliteratur zu Michelangelo einen geringeren Stellenwert ein. Zudem herrscht die Einzelbetrachtung, die sich mit jeweils einer ausgewählten Selbstdarstellung beschäftigt, als dominierende Publikationsform vor. Einige Selbstdarstellungen wurden außerdem im Rahmen von Künstlermonographien untersucht. Diese Arbeiten erbrachten eine Fülle neuer Ergebnisse zu den einzelnen Selbstdarstellungen Michelangelos. Lediglich zwei Forschungsarbeiten unternahmen bislang jedoch den Versuch, Michelangelos Selbstdarstellungen in Form einer zusammenhängenden Untersuchung zu beleuchten. Anzuführen ist hier zunächst die Dissertation von Aileen June Wang, die aufzeigt, inwieweit der Künstler literarische und visuelle Medien nutzt, um ein Bild seiner selbst zu kreieren und dieses zu kommunizieren.[21] Dabei greift die Autorin in ihrer Argumentation mit der Besprechung von Ascanio Condivis (Auto)Biographie, der Florentiner Pietà, den Fresken in der Cappella Paolina, der Selbstdarstellung im Jüngsten Gericht sowie der Inschrift auf dem einzigen signierten Werk des Künstlers, der Pietà in Sankt Peter, leider nur auf vier ausgewählte künstlerische Selbstpräsentationen sowie auf eine literarische Quelle zurück und bietet damit lediglich eine selektive, nicht aber umfassende und kontextualisierte Perspektive an; zudem ist ihre Argumentation einzig auf das Verständnis von Michelangelo als Künstler göttlicher Weisung zugespitzt. Auch Paul Barolskys Arbeiten kreisen immer wieder um Michelangelos Selbstdarstellungen.[22] In seiner 1990 erschienenen essayistischen Abhandlung Michelangelo’s Nose unternimmt der Autor als erster den Versuch, Michelangelos persona in ihrer Gesamtheit nachzuspüren und in den Werken das Streben des Künstlers nach spiritueller Überformung und Perfektionierung nachzuweisen. Problematisch erscheint bei Barolskys Argumentation – neben dem grundsätzlichen Verzicht auf Anmerkungen und Verweise – nicht nur eine scheinbar willkürliche Zuordnung unterschiedlichster Identifikationsfiguren, die von Sokrates und Homer über Dante zu Paulus und David, Machiavellis Fürsten und sogar bis hin zu Christus und Gottvater reichen, in die Michelangelo seinen Selbstausdruck scheinbar kleidete. Indem sich der Autor fast ausschließlich auf literarische Einflussquellen stützt, verliert er die historischen und sozialen Umstände der Renaissance als Epoche aus den Augen, die das Leben eines jeden Zeitgenossen prägten und bedingten. Wie John Onians in einer kritischen Rezension treffend bemerkt, scheint Barolsky seine eigene Belesenheit auf Michelangelo übertragen zu wollen.[23] Dadurch gelingt es Barolsky leider nur selten, Bezüge zu zeitgenössischen Konstanten herzustellen; die gesamte Studie erscheint trotz vielfältiger neuer Ansätze und Ergebnisse in weiten Teilen überinterpretiert.
Das Fehlen einer kontextualisierten Gesamtbetrachtung der Selbstdarstellungen Michelangelos lieferte demnach den Anstoß für die Entstehung der vorliegenden Arbeit. Die Zielsetzung der Untersuchung aber weist über eine summarische Besprechung der Selbstdarstellungen hinaus, führt die Eingangs skizzierte These von Michelangelo als Künstler, der in unterschiedlichen sozialen Kontexten agiert, doch unmittelbar zu einer kritischen Revision des Michelangelo-Bildes, welches an vielen Stellen in der Forschung gezeichnet wurde und wird. Selbst in neueren Arbeiten finden sich noch häufig Rezeptionsmuster vom Künstler als existentialistischem Außenseiter oder vom gottgesandten Genie, welche die Michelangelo-Forschung bereits am Beginn des 20. Jahrhunderts ausbildete.[24] Auch für die Untersuchung der Selbstdarstellungen des Künstlers finden sich entsprechende Positionen. Die bereits erwähnte Arbeit von Aileen June Wang ist auf den – von Vasari vorgeprägten – Topos fixiert, der göttliche Künstler sei das vom Himmel gesandte Genie, das im Auftrag des Herrn göttliche Kunstwerke erschaffe.[25] Eine ganz andere Auffassung vertritt dagegen Erna Fiorentini in ihrer Dissertation, in der sie sich mit den Gattungen Porträt und Selbstporträt in der Bildhauerkunst beschäftigt.[26] Zwar führt die Autorin Michelangelo als „[...] herausragendes Beispiel intellektueller Emanzipation des Bildhauers im Italien des 16. Jahrhunderts [...]“ an.[27] Doch klammert sie ihn in ihrer Untersuchung explizit aus mit der Begründung, „Michelangelos Selbstverständnis als Künstler [ergebe] sich aus einer bis zur letzten Konsequenz geführten Auseinandersetzung und Assimilation neoplatonischer Ästhetik [...]“, die die Autorin allein unter Bezugnahme auf die Untersuchungen Erwin Panofskys begründet.[28]
In eine entgegengesetzte Richtung weist die vorliegende Arbeit. Es ist hier nicht das Ziel, Michelangelos Selbstdarstellungen auf eine einzige und allgemein gültige, allumfassende Rolle zu reduzieren und alle Kunstwerke unter einer singulären Prämisse zu vereinen. Vielmehr ermöglicht der Blick gerade auf die unterschiedlichen Kontexte, deren situatives und soziales Umfeld die Entstehung der Werke maßgeblich beeinflusste, eine bewusst offene, möglicherweise auch ambivalente Beantwortung der Forschungsfragen, die, ohne im Vorfeld ein festes Korsett zu schnüren, ein umfassenderes Bild des Künstlers zu zeichnen vermag.[1] Michelangelo, Skulptur des Lorenzo de’ Medici, um 1525, Marmor, Höhe 178 cm, Florenz, San Lorenzo, Neue Sakristei und Michelangelo, Skulptur des Giuliano de’ Medici, um 1526–1534, Marmor, Höhe 173 cm, Florenz, San Lorenzo, Neue Sakristei. Zur Kirche San Lorenzo in Florenz als favorisierter Grablege der Medici-Dynastie siehe Zöllner u.a. 2007, S. 238–241 und S. 430 f. (Zöllner).
[2] Brief des Niccolò Martelli vom 28. Juli 1544. Übersetzung zitiert nach Preimesberger 1999 A, S. 247. „M. solo e unico al mondo, nella libreria di S. Lorenzo della città di Firenze, avendo in quella a scolpire i signori illustri della felicissima casa de’ Medici, non tolse dal Duca Lorenzo né dal Sig. Giuliano il modello appunto come la natura gli aveva effigiati e composti, ma diede loro una grandezza, una proporzione, un decoro, una grazia, uno splendore, qual gli parea che più lodi loro arrecassero, dicendo che di qui a mille anni nessuno non ne potea dar cognizione che fossero altrimenti, di modo che le genti in loro stessi, mirandoli, ne rimarrebbero stupefatti.“, zitiert nach Vasari-Barocchi 1962, Bd. 3, S. 993.
[3] Eine frühe Quelle zum Postulat der Ähnlichkeit findet sich im 34. Buch von Plinius’ Naturalis Historiae (34.16), wo von der Sitte berichtet wird, verdienten Menschen Standbilder anzufertigen, siehe Plinius 1989, S. 22 f.
[4] Vgl. dazu ausführlich Preimesberger 1999 A, S. 249 f. und darauf aufbauend Spanke 2004, S. 90–99. Daniel Spanke weist darüber hinaus darauf hin, dass eine separate Veröffentlichung zur Porträttheorie Michelangelos bislang ein Desiderat der Forschung geblieben ist, siehe Spanke 2004, S. 90, Anmerkung 11. Zur Nachahmungstheorie Vincenzo Dantis, in der die Prinzipien des ritrarre (dies meint die kopierende Nachbildung) und des imitare (hier ist die künstlerische Überformung hin zur Vollkommenheit gemeint) gegeneinander abgewägt werden, siehe Preimesberger 1999 B. Zu den Attributen der Capitani siehe Zöllner u.a. 2007, S. 244 und S. 430 f. (Zöllner), hier auch mit einer Diskussion der Forschungsliteratur vor allem hinsichtlich der Identifikation der Capitani. Alexander Perrig kommt zu dem Schluss, Michelangelo habe im Giuliano de’ Medici die Züge Cavalieris wiedergegeben, siehe Perrig 1991, S. 79. Ihm folgt Nicole Hegener, siehe Hegener 2008, S. 293.
[5] Preimesberger 1999 A, S. 250.
[6] Vasari-Milanesi 1906, S. 270 und Vasari 2009, S. 196. Im Folgenden werden die Referenzen aus der 1568er Vita Giorgio Vasaris (ausführlich zu den einzelnen Versionen der Lebensbeschreibungen in Kapitel 2) immer jeweils für den italienischen Text (Vasari-Milanesi 1906) und die deutsche Übersetzung (Vasari 2009) angegeben. Für die entsprechende Referenzstelle im 35. Buch von Plinius’ Naturkunde (35.64) siehe Plinius 1978, Bd. 35, S. 54 f.
[7] Giorgio Vasari berichtet von einem Porträt, das Michelangelo von Tommaso de’ Cavalieri angefertigt habe, verweist aber ausdrücklich auf den Ausnahmecharakter dieses Ereignisses aufgrund der vollkommenen Schönheit des Knaben; vgl. dazu Vasari-Barocchi 1962, Bd. 4, S. 1904–1906 und Vasari 1906, S. 271 f.: „Ritrasse Michelagnolo messer Tommaso in un cartone, grande di naturale, che nè prima nè poi di nessuno fece il ritratto, perchè aboriva il
fare somigliare il vivo, se non era d’infinita bellezza.“ (Übersetzung nach Vasari 2009, S. 197: „Auf einem großen Karton schuf Michelangelo ein naturgetreues Porträt von Messer Tommaso, obwohl er niemals zuvor noch danach irgend jemanden porträtiert hat, weil er das Nachahmen von Lebendem verabscheute, wenn es nicht von unermeßlicher Schönheit war.“)
[8] Zu dieser Tendenz zusammenfassend Koos 2006, S. 18 f.
[9] Burckhardt 1930, hier vor allem das Kapitel „Entwicklung des Individuums“, S. 95–123 und im Besonderen S. 95–103.
[10] Köstler 1998, S. 12 f. mit einem kurzen Überblick über die Dekonstruktion des Burckhardt’schen Theorems in der jüngeren Forschung und deren Erfolge, die Entdeckung des Individuums zum einen vor dem Zeitalter der Renaissance, zum anderen in außereuropäischen Kulturen fassbar zu machen. Siehe auch Brändle u.a. 2001, S. 3–7. Zu den weit verzweigten Dimensionen des Burckhardt’schen Verständnisses vom Individuum in Relation zu Burckhardts Selbstkonzept und der Problematik, die bei der Übersetzung des Begriffes Individuum entsteht, siehe etwa Weissman 1989, S. 269–271 und Weintraub 2004.
[11] Zum Mittelalter als „Epoche der Individualität“ siehe vor allem Bredekamp 2000, der hier die Künstlersignatur als wichtigen Verweis auf den Individualitätsbegriff deutet. Bredekamp formuliert hier ferner die These, dass „[...] in der Frührenaissance nicht aus dem Grund unablässig Portraits gemalt [wurden], weil die Menschen ihr individuelles Selbst entdeckt haben, sondern weil ihnen aufging, daß es verloren oder zumindest bedroht war.“, siehe Bredekamp 2000, S. 236.
[12] Die poststrukturalistische Theorie geht davon aus, dass die strukturierende Macht der Zeichen zu einer kompletten Semiotisierung der Welt führt. Indem sich die Wirklichkeit in Zeichen erschöpft, gibt es keine außersemiotische Wirklichkeit mehr. Auch das Subjekt ist nur ein Produkt aus Zeichen. Siehe dazu auch Koos 2006, S. 18.
[13] Dazu maßgeblich Greenblatt 1984, insbesondere die Darlegung des Ansatzes in der Einleitung, S. 1–9.
[14] Zijlmans/ Halbertsma 1995, S. 26: „Ein Kunstwerk entsteht in einem historischen, raum-zeitlichen Kontext. [...] Der Schöpfer des Kunstwerkes hat seine eigene Geschichte und arbeitet in seinem eigenen historischen Kontext. Das Kunstwerk soll eine spezifische Wirkung ausüben, eine bestimmte Funktion für ein bestimmtes Publikum haben. [...] Möglicherweise liegt hier die tiefste Wurzel kunsthistorischer Forschung: dem Kunstwerk seinen authentischen Kontext zurückzugeben.“ Vgl. auch Jordanova 2005, besonders S. 45.
[15] Neben den Publikationen von Ulrich Pfisterer und Valeska von Rosen (Pfisterer/Rosen 2005) sowie von Joanna Woodall und Anthony Bond (Kat. Ausst. Self Portrait 2005) sei an dieser Stelle besonders auf die 1990 veröffentlichte Studie von H. Perry Chapman (Chapman 1990) hingewiesen, in der Rembrandts Selbstdarstellungen aus der Einbettung in konkrete kulturhistorische Zusammenhänge als Akte kontinuierlicher Identitätsformung und damit als Prozess der Selbstdefinition verstanden werden, mit denen er seinem sozialen Status und seinem künstlerischen Selbstverständnis Ausdruck verlieh.
[16] „‘Jeder Künstler malt sich selbst am besten’, hat Michelangelo einmal behauptet, aber an sich selbst hat er die Wahrheit dieses Spruches nie erprobt.“, siehe Steinmann 1913, S. 2. Steinmann erklärt dies mit dem Faustschlag Pietro Torrigianis, durch den Michelangelos Gesicht derartig entstellt wurde, dass der Künstler es nicht in einem Kunstwerk festhalten wollte. Steinmann verweist nur wenige Zeilen später auf Nikodemus in der Pietà im Florentiner Dom, in den Michelangelo seine Züge eingeschrieben habe.
[17] Federzeichnung, 36,5 x 25 cm, Paris, Musée du Louvre. Einerseits gilt die Zeichnung als Selbstdarstellung Michelangelos (Heimeran 1925, S. 100 f.; Calabrese 2006, S. 136, Abb. 128; Kat. Ausst. Il Volto di Michelangelo 2008, S. 14 f.), andererseits als Zeichnung von der Hand Baccio Bandinellis (Joannides 2003, S. 398–400, dort auch ein Forschungsüberblick; Kat. Ausst. Michelangelo 2008, S. 41).
[18] Zu Albrecht Dürer vgl. Koerner 1993. Zu den Selbstdarstellungen Baccio Bandinellis erschien 2008 eine ausführliche Monographie, siehe Hegener 2008.
[19] Zu den Kategorien der Selbstdarstellung Michelangelos vgl. Kapitel 1.4.1. Neben diesen Selbstdarstellungen sind in der Literatur weitere Vorschläge zu anderen Selbstdarstellungen zu finden, die im Allgemeinen auf einer rein physiognomischen Identifikation beruhen (zu dieser Problematik vgl. insbesondere Kapitel 6). Exemplarisch angeführt sei hier der heilige Prokulus, 1494/ 95, Marmor, Höhe mit Basis 58,5 cm, Bologna, Basilika S. Domenico, Arca di San Domenico bei Thode. Ende der Renaissance 1912, Bd. 3/1, S. 94. Für verschiedene Vorschläge in der älteren Literatur, Selbstdarstellungen des Künstlers in den Fresken im Sixtinischen Gewölbe zu identifizieren, siehe Heimeran 1925, S. 82–87. Bei Heimeran 1925, S. 90–101 findet sich auch eine Zusammenstellung mit vorgeschlagenen Selbstdarstellungen in den Zeichnungen. Die Ärzte Lennart und Anne-Greth Bondeson sehen im Gottvater in den Fresken des Sixtina-Gewölbes (1508–1512) eine Selbstdarstellung des Künstlers, denn er habe den Kropf, den er im Gedicht an Giovanni da Pistoia beschreibt, am Halse Gottes angefügt, siehe Bondeson 2001.
[20] Zu diesen Tendenzen vgl. Wittkower 1965, S. 42–58; Kemp 1974; Winner 1992 a, S. 1; Zöllner 2002, S. 116; Hegener 2008, S. 21 f. Siehe hierzu auch ausführlicher Kapitel 1.3.
[21] Wang 2005.
[22] Anzuführen ist hier in erster Linie Barolsky 1990 und darüber hinaus Barolsky 1994.
[23] Onians 1990.
[24] James Beck sieht in Michelangelo den Künstler in göttlicher Mission, siehe Beck 2001, S. 21–30. Zur Konstruktion des Göttlichen vgl. Emison 2004. Henry Thode beispielsweise sieht in Michelangelo den starken, leidenschaftlichen, wütenden Künstler verkörpert, dessen terribilità in ihrer ganzen Heftigkeit zum Ausdruck kommt, siehe dafür Thode. Ende der Renaissance 1902, Bd. 1, S. 229–234. Vgl. zu Michelangelos Persönlichkeit auch Wittkower 1965. Zu Michelangelo als Einzelgänger vgl. außerdem Vasari-Milanesi 1906, S. 270 f. und Vasari 2009, S. 196 sowie Vasari-Barocchi 1962, Bd. 4, S. 1859–1870 mit Quellen und Sekundärliteratur vom 16. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Nichtsdestotrotz ist bekannt, dass Michelangelo langjährige intensive Freundschaften unter anderem mit Tommaso de’ Cavalieri, Sebastiano del Piombo und Vittoria Colonna pflegte, siehe dazu ebenfalls die Berichte Giorgio Vasaris in Vasari-Milanesi 1906, S. 270 f. und Vasari 2009, S. 196 sowie in Vasari-Barocchi 1962, Bd. 4, S. 1859–1882. Anzuführen ist hier auch Joseph Imordes umfassende und scharfsinnige Analyse der Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte Michelangelos in Deutschland, in der er immer wieder auf die Typisierungen des Künstlers durch die Literatur zu sprechen kommt, siehe Imorde 2009.
[25] Wang 2005. Vgl. Vasari 2009, S. 32.
[26] Fiorentini 1999.
[27] Fiorentini 1999, S. 4.
[28] Fiorentini 1999, S. 4 mit Anmerkung 14.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden